IN MEMORIAM-Geburtstage IM DEZEMBER 2020
Berücksichtigt wurden runde und halbrunde Geburtstage.
Zusammenstellung der Liste: Walter Nowotny
1.12. Ricardo YOST: 85. Geburtstag

Ricardo Yost und Renato Cesari in „Don Pasquale
Er studierte in seiner Geburtsstadt Rosario (Argentinien), dann in Italien bei Adelaide Saraceni und Carlo Tagliabue. 1973 wurde er an das Teatro Colón Buenos Aires verpflichtet, wo er in den folgenden zwanzig Jahren in großen Partien auftrat. Er sang hier u.a. den Guglielmo in »Così fan tutte«, den Enrico in »Lucia di Lammermoor«, den Rigoletto, den Amonasro in »Aida« (den er noch 1996 dort sang), den Jago in Verdis »Otello«, den Malatesta im »Don Pasquale«, den Renato in »Un ballo in maschera« von Verdi, den Michonnet in »Adriana Lecouvreur« von Cilea, den Escamillo in Carmen, den Lescaut in »Manon« von Massenet und 1973 den Napoleon in der südamerikanischen Erstaufführung der Oper »Krieg und Frieden« von Prokofjew. Er gastierte auch an anderen Opernhäusern in Südamerika, so regelmäßig in Santiago de Chile, aber auch in Rio de Janeiro, am Opernhaus von Lima und am Teatro Argentino in La Plata. 1977 hörte man ihn an der Oper von Tel Aviv in Verdis »Un ballo in maschera«; in Salzburg sang er den Escamillo, 1980 längeres Gastspiel an der Niederländischen Oper in Amsterdam, auch in Belgien, Frankreich und in den skandinavischen Ländern aufgetreten. In einem späteren Abschnitt seiner Karriere übernahm er auch Bass-Partien wie den Mephisto im »Faust« von Gounod und den Basilio im »Barbier von Sevilla«. 1998 trat er am Teatro Colón Buenos Aires als Don Pasquale von Donizetti auf. 1999 sang er am Teatro Colón Buenos Aires den Don Ignacio Del Puente in der Oper »Aurora« des argentinischen Komponisten Hector Panizza, auch den Mr. Kofner in »The Consul« von C.G. Menotti, 2000 am Opernhaus von Córdoba (Argentinien) den Don Liborio in »Il Matrero« von Felipe Boero, am Teatro Colón in »Francesca da Rimini« von R. Zandonai. Er starb 2006 in Buenos Aires.
1.12. Helga KOSTA: 100. Geburtstag

Sie war die Tochter eines Sängerehepaars. Ihre Mutter Elsa Koch (* 1894 Moskau, † 20.6.1953 Basel) hatte bereits in Moskau Gesang studiert, wurde dann im Ersten Weltkrieg mit ihrer Familie in Sibirien als Deutsche interniert, schließlich nach Deutschland entlassen, wo sie ihre Ausbildung bei Selma Nicklass-Kempner in Berlin beendete. Sie kam sogleich an die Berliner Hopfoper (Debüt als Konstanze in der »Entführung aus dem Serail« und als Rosina im »Barbier von Sevilla«), sang 1918-22 in Dessau, unternahm 1922-23 eine Südamerika-Tournee und war dann am Großen Schauspielhaus Berlin (1923-24 als Operettensängerin), in Königsberg, Danzig und 1927-31 am Stadttheater von Basel engagiert, wo sie wie bei Gastspielen und Konzerten als Koloratrice in Erscheinung trat. Sie war verheiratet mit dem Tenor Gustav Stabinsky (* 1893, † 1977 Thun), der hauptsächlich als Operettentenor und als Tenorbuffo hervortrat und am Berliner Metropol-Theater wie auch 1927-31 in Basel engagiert war, wo er noch lange Jahre als Gast sang. – Helga Kosta wurde durch ihre Großtante Emma Koch, eine Schülerin von Franz Liszt, im Klavierspiel ausgebildet, entschloss sich dann aber zur Sängerlaufbahn und wurde Schülerin ihrer Eltern, vor allem ihrer Mutter. 1938 begann sie ihre Karriere mit Rundfunkauftritten in der Schweiz und gab, noch als Helga Stabinsky, erste Lieder- und Arienabende. 1943 nahm sie den Künstlernamen Kosta an (aus den Anfangssilben der Namen ihrer Eltern gebildet); 1945 heiratete sie den Dirigenten, Geiger und Komponisten C.V. Menz, von dem sie sich später wieder trennte. 1948 debütierte sie am Städtebundtheater Biel-Solothurn in ihrer Glanzrolle, der Königin der Nacht in der »Zauberflöte«. 1950-60 war sie Mitglied des Theaters der Schweizer Bundeshauptstadt Bern. Hier sang sie mit großem Erfolg Partien wie die Konstanze in der »Entführung aus dem Serail«, die Susanna wie den Cherubino in »Figaros Hochzeit«, die Zerline im »Don Giovanni«, die Gilda im »Rigoletto«, die Mimi in »La Bohème«, die Sophie im »Rosenkavalier«, den Ighino in »Palestrina« von Hans Pfitzner, die Lakmé von Delibes und die Gretel in »Hänsel und Gretel«. Gastspiele am Opernhaus von Zürich, in St. Gallen, an den Opernhäusern von Köln und Bonn (1956 als Königin der Nacht), zahlreiche Konzert- und Rundfunkauftritte im Schweizer wie im deutschen Rundfunk kennzeichneten die weitere Laufbahn der Künstlerin. 1969 musste sie krankheitshalber ihre Karriere aufgeben. Sie betätigte sich im pädagogischen Bereich und lebte später in Thun in der Schweiz. Sie starb 2014 in Steffisburg.
Lit.: M. Schimmrich: »Helga Kosta« (Münster, 1989).
Schallplatten: Decca (Cedric Dumont) mit Volks- und Operettenliedern, dazu zahlreiche Radio-Mitschnitte; von ihren Eltern sind einige Titel auf Electrola (Duette aus Operetten) aufgenommen worden.
2.12. Thomas PALMER: 85. Geburtstag
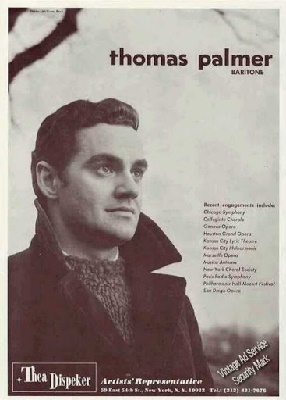
Gesangstudium an der Academy of Vocal Art und an der Juilliard School of Music New York. Bühnendebüt 1966 in Kansas City als Valentin im »Faust« von Gounod. 1967 sang er sehr erfolgreich den Marcello in »La Bohème« am Grand Théâtre Genf und den Grafen in »Le nozze di Figaro« am Teatro Margherita in Genua, 1968 die gleiche Partie bei den Festspielen von Aix-en-Provence. Seine Karriere erreichte ihren Höhepunkt an den großen Opernhäusern in Nordamerika: er trat 1968 an der Oper von San Diego als Papageno in der »Zauberflöte« auf, 1977-78 an der Oper von Miami (u.a. als Ford im »Falstaff« von Verdi), an der Santa Fé Opera als de Siriex in »Fedora« von Giordano. Er gastierte an den Opernhäusern von Houston (Texas) und San Francisco (1968 als Escamillo in »Carmen«), schließlich auch an der New Yorker Metropolitan Oper, wo er in der Spielzeit 1974-75 den Silvio im »Bajazzo« und den Sharpless in »Madame Butterfly« in insgesamt vier Vorstellungen sang. Man schätzte ihn als Interpreten mehr lyrisch gearteter Partien, zumal als Mozartsänger. Zugleich bedeutender Konzert- und Oratoriensänger. Er starb im 1994 in Clearwater (Florida).
Schallplatten: RCA (»Medea in Corinto« von Simone Mayr, 1972).
2.12. Wolfgang WEBER: 85. Geburtstag
Er arbeitete seit den 1960er Jahren als Regisseur in Österreich, hauptsächlich in Wien an der Wiener Staatsoper und an der Wiener Volksoper. Erstmals inszenierte er 1963 eine Produktion der Wiener Staatsoper, die komische Oper Die Kluge im Theater an der Wien mit Evelyn Lear und Thomas Stewart in den Hauptrollen. 1973 wurde er unter der Direktion von Karl Dönch fest als Regisseur an die Wiener Volksoper engagiert. Er wurde außerdem gemeinsam mit dem Regisseur Robert Herzl Dönchs persönlicher Referent. Ab 1976 war er gleichzeitig Oberspielleiter der Operette. An der Wiener Volksoper inszenierte er unter anderem die Opern Kleider machen Leute von Alexander Zemlinsky (1973), Notre Dame (1975, mit Walter Berry und Julia Migenes), Albert Herring (1976), Ein preußisches Märchen von Boris Blacher (1978, mit Ernst Gutstein), Schwanda, der Dudelsackpfeifer von Jaromir Weinberger (1980, mit Ernst Gutstein und Mirjana Irosch), Aus einem Totenhaus (1981) und Viva la Mamma (1983). Weber inszenierte mehrfach auch bei Erst- und Uraufführungen. Im Februar 1972 inszenierte er, mit Ernst Gutstein in der Titelrolle, die Uraufführung der Oper König Nicolo von Rudolf Weishappel 1975 folgte die Inszenierung der Uraufführung der Oper Der eingebildete Kranke von Franz Alfons Wolpert. Außerdem führte er 1982 Regie bei dem Musical West Side Story. Bei der deutschsprachigen Erstaufführung von West Side Story 1968 an der Wiener Volksoper mit Julia Migenes und Adolf Dallapozza hatte Weber neben dem Regisseur Allan Johnson bereits die Spielleitung bei der Dialogregie und die Co-Regie bei der Choreographie übernommen. An der Wiener Staatsoper inszenierte er 1981 die österreichische und deutschsprachige Erstaufführung von Leonard Bernsteins Musiktheaterstück Mass. 1982 wurde er Oberspielleiter an der Wiener Staatsoper. Dort inszenierte er unter anderem die Premieren von Lulu (1983) und von Die Entführung aus dem Serail (1985) für eine Tournee der Wiener Staatsoper durch die österreichischen Bundesländer. Außerdem war er als Regisseur für die szenischen und musikalischen Neueinstudierungen von La fanciulla del West (1988) und Lohengrin (1990) verantwortlich. 1986-91 leitete er als Regisseur gemeinsam mit dem Dirigenten Ernst Märzendorfer das Opernstudio der Wiener Staatsoper, für das er ebenfalls eigene Regiearbeiten übernahm. Weber, der auch international als Regisseur tätig war, war als szenischer Mitarbeiter auch Assistent Herbert von Karajans bei dessen Inszenierungen bei den Salzburger Festspielen und bei den Salzburger Osterfestspielen. Weber inszenierte regelmäßig immer wieder auch als Gastregisseur in Deutschland. 1968 führte er am Opernhaus Nürnberg Regie bei der Uraufführung der Oper Die Witwe des Schmetterlings von Isang Yun. 1990 übernahm er dann am Opernhaus Nürnberg die Neuinszenierung der Oper Tannhäuser (Titelrolle: Karl-Heinz Thiemann; Musikalische Leitung: Christian Thielemann). 1997 inszenierte er zur Spielzeiteröffnung 1997/98 die Neuproduktion der Oper Il trovatore am Theater Aachen. Er starb im Juni 2010.
2.12. Ivana MIXOVÁ: 90. Geburtstag

Sie stammte aus einer tschechischen Familie. Gesangsausbildung am Konservatorium von Brno (Brünn) durch G. Redlichová und Bohumil Sobesky sowie bei Konstantin Karenin. Debüt 1950 am Staatstheater von Olomouc (Olmütz) als Berta in Rossinis »Barbier von Sevilla«. Sie war 1950-53 am Theater von Olomouc, 1953-56 am Theater von Ostrava (Mährisch Ostrau), seit 1956 am Nationaltheater Prag engagiert, wo sie eine sehr erfolgreiche Karriere entfaltete. Gastspiele an den Nationalopern von Budapest, Sofia und Budapest, an der Berliner Staatsoper, an den Opernhäusern von Zürich, Frankfurt a.M., Nürnberg, Helsinki, Hannover, beim Holland Festival in Amsterdam (1959 als Varvara in »Katja Kabanowa« von Janácek, 1963 als fremde Fürstin in »Rusalka« von Dvorák, 1980 als Lotinka in »Der Jakobiner«, ebenfalls von Dvorák) und in Bologna. Am 4.4.1974 wirkte sie an der Prager Oper in der Uraufführung der Oper »Coriolanus« von Cikker mit. Die Sängerin, die zur verdienten Künstlerin der CSSR ernannt wurde, hatte ihre Glanzrollen im lyrischen Stimmfach, u.a. als Cherubino in »Le nozze di Figaro«, als Olga im »Eugen Onegin«, als Prinzessin Eboli im »Don Carlos« von Verdi und als Orpheus von Gluck. Weitere Bühnenpartien: die Carmen, die Magdalene in »Die Meistersinger von Nürnberg«, die Meg Page in Verdis »Falstaff«, die Klytämnestra in »Elektra« von R. Strauss, die Lola in »Cavalleria rusticana« und die Klara in »Die Verlobung im Kloster« von Prokofjew; dazu erfolgreiche Konzertaltistin. Sie starb 2002 in Prag.
Schallplatten: Supraphon (u.a. vollständige Opern »Der Jakobiner« von Dvorák, »Die Teufelswand« von Smetana, »Das schlaue Füchslein« und »Katja Kabanowa« von Janácek), Decca (»Jenufa«).
2.12. Francis CASADESUS: 150. Geburtstag
Nach seinen Studien am Pariser Konservatorium bei Albert Lavignac und César Franck wurde er Dirigent an der Pariser Oper und der Opéra-Comique. Mit den Orchestern dieser Opernhäuser tourte er durch Frankreich (1890–92) und Europa (1895). Zu seinem Schaffen zählen fünf Opern und eine Ballettmusik. Ab 1921 war er viele Jahre der erste Direktor des Amerikanischen Konservatoriums in Fontainebleau. 1942 wurde er zum Vizepräsidenten der SACEM, einer Institution vergleichbar mit der deutschen GEMA ernannt. Er starb 1954 in Paris.
3.12. Antonio BARASORDA: 75. Geburtstag
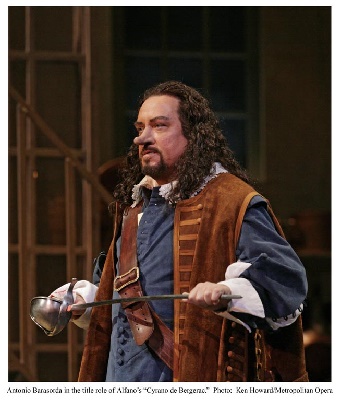
Sein Bühnendebüt erfolgte 1971 in San Juan auf Puerto Rico als Don Ottavio im »Don Giovanni« zusammen mit Justino Diaz und Fernando Corena. 1973 gewann er den Gesangwettbewerb der New Yorker Metropolitan Oper, 1975 in Paris den »Grand Prix National de la Critique«. Seit 1971 kam er zu großen Erfolgen bei Auftritten an der New York City Opera, an den Opern von Boston, San Francisco (1979 als Alfredo in »La Traviata«, 2002 als Otello von Verdi), Miami und Pittsburgh, in Santiago de Chile und bei den Festspielen von Wexford. Er gastiere am Opernhaus von Triest als Cavaradossi in »Tosca«, an der Opéra-Comique Paris als Graf Almaviva im »Barbier von Sevilla«, an der Oper von Marseille als Rodolfo in »Luisa Miller« von Verdi und sang 1986 am Teatro Fenice Venedig die Titelpartie in Verdis Oper »Stiffelio« als Partner von Rosalind Plowright. 1986-87 hörte man den Künstler an der Oper von San Diego in Bellinis »Norma«, zuvor bereits als Alfredo (den er auch 1984 in Los Angeles sang), in Bologna als Gennaro in »Lucrezia Borgia« von Donizetti, in Genua als Alfredo. An der Connecticut Opera gastierte er 1990 als Don José in »Carmen«, 1991 in »Djamileh« von Bizet und in »La Navarraise« von Massenet, in San Diego 1995 als Macduff in Verdis »Macbeth«, an der Portland Opera 1995-96 als Calaf in Puccinis »Turandot«. 1995 debütierte er als Canio im »Bajazzo« an der Metropolitan Oper New York (nachdem er im Jahr davor bereits in zwei Vorstellungen der MET in Freiluftaufführungen in den Parkanlagen von New York den Cavaradossi gesungen hatte). Bis 2006 sang er an der Metropolitan Oper in insgesamt 23 Vorstellungen auch den Radames in »Aida«, den Manrico im »Troubadour«, den Oberpriester in Mozarts »Idomeneo«, den Pollione in Bellinis »Norma« sowie die Titelhelden in Giordanos »Andrea Chénier« (als Einspringer für Plácido Domingo) und Alfanos »Cyrano de Bergerac«. 1997 gastierte er bei der Miami Opera als Canio, 1998 als Calaf, an der Staatsoper Dresden 1998 als Luigi in Puccinis »Il Tabarro«. 2000 gastierte er an der Oper von Montreal in der Titelrolle von Verdis »Otello«. Auch Gastspiele am Teatro Colón Buenos Aires, am Teatro de la Zarzuela in Madrid, bei der Welsh Opera Cardiff, an der Oper von Caracas und bei den Festspielen in der Arena von Verona (als Don José). Aus seinem reichhaltigen Repertoire für die Bühne verdienen noch der Tamino in der »Zauberflöte«, der Pinkerton in »Madame Butterfly«, der Hoffmann in »Hoffmanns Erzählungen«, der Mylio in »Le Roi d’Ys« von Lalo, der Rinuccio in »Gianni Schicchi« von Puccini, der Edgardo in »Lucia di Lammermoor« und der Fenton in Verdis »Falstaff« Erwähnung. Er starb 2018 in San Juan (Puerto Rico).
Schallplatten: Decca (»Macbeth« von Verdi), Mondo Musica (Titelrolle in Verdis »Stiffelio«, Teatro Fenice Venedig 1975).
3.12. József ELLINGER: 200. Geburtstag

Er begann seine Bühnenlaufbahn 1845 am Opernhaus von Bratislava (Preßburg) als Chorist; 1846 trat er dem Chor des Deutschen Opernhauses in Budapest bei, übernahm aber auch schon gelegentlich kleinere Rollen. 1847 ging er zur weiteren Ausbildung nach Wien und wurde Schüler von Hippel. 1847 fand er sein erstes Engagement als Solist am Stadttheater von Regensburg. Er sang nachfolgend in Augsburg und München und schließlich 1851 in Graz. 1851-52 hatte er an den Hofopern von Wien und Dresden, hauptsächlich in Partien aus dem italienischen Fach, große Erfolge. 1854 wurde er als erster Tenor an die Ungarische Nationaloper Budapest berufen, an der er eine glänzende Karriere zur Entwicklung brachte. Man schätzte ihn vor allem als Wagner-Tenor; er kreierte die großen Wagner-Heroen für Budapest: 1866 den Lohengrin, 1872 den Tannhäuser, 1874 den Rienzi, 1873 den Erik in »Der fliegende Holländer«. Am 9.3.1861 sang er in Budapest in der Uraufführung der ungarischen Nationaloper »Bánk Bán« von Ferenc Erkel die Titelpartie. Mit seiner groß dimensionierten heldischen Tenorstimme bewältigte er im Übrigen ein weitläufiges Bühnenrepertoire. 1880 gab er seine Karriere auf. Er starb 1891 in Ujpest. Er war verheiratet mit der Sopranistin Teresa Engst († 1898 Budapest), die zuerst an der Hofoper von Stuttgart und später mit ihm zusammen in Budapest auftrat. Aus dieser Ehe stammte die Tochter Joszefa Ellinger (1852-1920), die gleichfalls eine bekannte Sängerin wurde.
4.12. William HOLLEY: 90. Geburtstag

Er erhielt in seiner amerikanischen Heimat Gesangunterricht bei Anna Kaskas, bei Frank St. Leger und bei Louis Cunningham. Er sang 1958-59 am Theater von Flensburg, dann 1959-67 am Theater von Gelsenkirchen, 1965-67 am Opernhaus von Essen und war in den langen Jahren von 1966 bis 1984 an der Deutschen Oper am Rhein Düsseldorf-Duisburg verpflichtet. Bereits 1961 gastierte er am Landestheater Salzburg als Titelheld im »Faust« von Gounod. Durch Gastverträge war er der Deutschen Oper Berlin (1971-79), der Bayerischen Staatsoper München (1971-76) und der Staatsoper Stuttgart (1973-82) verbunden. Gastspiele führten ihn u.a. an das Opernhaus von San Francisco (1968 als Don Ottavio im »Don Giovanni«), an die Staatsoper Wien (1971-77 als Cavaradossi in »Tosca«, als Laça in Janáceks »Jenufa«, als Froh im »Rheingold«, als Rodolfo in »La Bohème« und als Don Carlos in Verdis gleichnamiger Oper), an die Königliche Oper Kopenhagen, an das Opernhaus von Nizza, an die Hamburger Staatsoper, an die Niederländische Oper Amsterdam (1973), an das Teatro San Carlo Neapel, an das Gran Teatre del Liceu in Barcelona, an die Oper von Houston/Texas (1976) und zu den Festspielen von Athen. Bei den Salzburger Festspielen wirkte er 1969-73 in den Aufführungen der Barock-Oper »Rappresentatione di Anima e di Corpo« von Cavalieri (1970 auch als 1. Geharnischter in der »Zauberflöte«) mit. Sein Rollenrepertoire für die Bühne war sehr umfangreich und enthielt Partien wie den Tamino in der »Zauberflöte«, den Ferrando in »Così fan tutte«, den Belmonte in der »Entführung aus dem Serail«, den Belfiore in »La finta giardiniera« von Mozart, den Herzog im »Rigoletto«, den Alfredo in »La Traviata«, den Titelhelden in »Hoffmanns Erzählungen«, den Narraboth in »Salome« von R. Strauss, den Hans in Smetanas »Die verkaufte Braut«, den Fenton in Nicolais »Die lustigen Weiber von Windsor«, den italienischen Sänger im »Rosenkavalier«, den Ismaele in Verdis »Nabucco«, den Riccardo in »Un Ballo in maschera«, den Des Grieux in »Manon Lescaut« von Puccini, den Dick Johnson in »La Fanciulla del West«, den Calaf in »Turandot«, den Luigi in Puccinis »Il Tabarro«, den Andrea Chénier in Giordanos bekannter Oper, den Don José in »Carmen«, den Lenski im »Eugen Onegin« von Tschaikowsky und den Hermann in dessen »Pique Dame«. Er war zeitweilig mit der Sängerin Carin Schroeder verheiratet, die in den sechziger Jahren am Stadttheater von Gelsenkirchen wirkte. Er starb 2019 in Plant City (Florida).
Schallplatten: Orfeo (Angelo custode in »Rappresentazione di anima e di corpo« von Cavalieri, Salzburg 1971).
4.12. Francesco Maria DALLE ASTE: 200. Geburtstag
Er war Chorknabe am Dom seiner Heimatstadt Roveredo und erhielt dort ersten Unterricht durch den Domkapellmeister Müller. Weitere Ausbildung in Wien durch den großen Bassisten Joseph Staudigl sr. Er begann seine Karriere in Wien, sang dann 1841-42 am Theater von Salzburg, 1842-43 am Stadttheater von Innsbruck und schloss sich für die Saison 1843-44 der italienischen Operngesellschaft Romani an, die in den größeren Städten in Böhmen Gastspiele gab. 1844-45 war er am Theater in der Josefstadt, 1845-47 am Theater an der Wien in Wien tätig. 1847-49 war er am Stadttheater Hamburg, 1849-52 an der Hofoper von Dresden engagiert. 1850 gastierte er am Opernhaus von Riga als Bertram in »Robert der Teufel« und als Marcel in den »Hugenotten« von Meyerbeer, als Sarastro in der »Zauberflöte«, als Figaro in »Figaros Hochzeit« und als Plumkett in Flotows »Martha«. 1852-54 trat er in Lissabon und Paris sowie in seiner Geburtsstadt Roveredo auf, 1852 auch am Teatro Comunale von Bologna. 1855-60 war er am Hoftheater von Darmstadt engagiert, das er 1860 unter Kontraktbruch verließ. Darauf war er 1860-68 Mitglied des Deutschen Theaters in Rotterdam. Schließlich gastierte er 1868-69 noch in Breslau und 1869-70 in Frankfurt a.M. 1877 eröffnete er in Bozen eine Gesangschule, lebte aber später als Pädagoge in Berlin. Er sang während seiner Bühnenkarriere seriöse wie auch Buffo-Partien, vor allem aus dem italienischen und dem französischen Repertoire der damaligen Spielpläne, war aber auch ein geschätzter Konzertbassist. 1857 wirkte er in Darmstadt in der deutschen Erstaufführung von Verdis »Die sizilianische Vesper« als Procida mit. Aus seinem Repertoire sind noch folgenden Partien zu nennen: der Conte Rodolfo in »La Sonnambula« von Bellini, der Giorgio in »I Puritani« vom gleichen Komponisten, der Peter Michailow im »Nordstern« von Meyerbeer und der Jacob in »Joseph« von Méhul. Seit 1886 lebte er als Pädagoge in Berlin.
5.12. Nicola FILACURIDI: 100. Geburtstag

Er wurde durch einen italienischen Pädagogen in Alexandria ausgebildet und debütierte dort 1945 als Turiddu in »Cavalleria rusticana«. Es schloss sich ein Engagement an der Oper von Kairo an, schließlich ging er nach Italien und vollendete dort seine Studien bei Federico Dal Cupulo. 1949 begann er seine italienische Karriere am Stadttheater von Savona in der Partie des Alfredo in »La Traviata«. Große Erfolge bei einem Gastspiel in Triest und bei einer Spanien-Tournee. 1950 Gastspiel an der Oper von Rio de Janeiro, im gleichen Jahr sang er an der Oper von Rom den Maurizio in »Adriana Lecouvreur« von Cilea. Er trat an den Opernhäusern von Venedig, Neapel, Parma und Turin, beim Maggio Musicale von Florenz, dann auch an der Mailänder Scala auf. An der Scala debütierte er 1953 als Albert in der italienischen Erstaufführung der modernen Oper »Leonore 40/45« von Liebermann. Hier wirkte er am 26.1.1957 in der Uraufführung der Oper »Dialogues des Carmélites« von Fr. Poulenc als Chevalier de la Force mit; er hatte an der Scala 1957 als Julien in »Louise« von Charpentier und als Kardinal in »Mathis der Maler« von P. Hindemith, 1958 als Maurizio und als Don Giovanni in »Der steinerne Gast« von Dargomyschski, 1960 als Chlestakow in Werner Egks »Der Revisor« sowie 1961 als Disperato in »Torneo notturno« von Malipiero und als Hoffmann in »Hoffmanns Erzählungen« besondere Erfolge. Es folgten Auftritte im italienischen Rundfunk und im Fernsehen, Gastspielreisen in Frankreich, Belgien, Portugal, Deutschland und Spanien. 1948-51 gastierte er an der Oper von Monte Carlo, 1949 am Théâtre de la Monnaie Brüssel, 1957 bei den Festspielen von Aix-en-Provence (als Don José in »Carmen«), 1956 an der Londoner Covent Garden Oper, 1958 an der Oper von Dallas, 1960 bei den Festspielen von Glyndebourne (als Arturo in »I Puritani« von Bellini), dann auch an der Staatsoper von Wien (1957-60 als Don José, als Pinkerton in »Madame Butterfly« und als Alfredo) und an der Australian Opera Sydney (1976). 1955 wirkte er in Palermo in der Uraufführung der Oper »Il Capello di Paglia di Firenze« von N. Rota mit. Weitere Partien aus seinem Repertoire, das 65 Rollen umfasste, waren der Nadir in »Les pêcheurs de perles« von Bizet, der Faust von Gounod, der Werther von Massenet, der Herzog im »Rigoletto«, der Riccardo in Verdis »Un ballo in maschera«, der Edgardo in »Lucia di Lammermoor«, der Idomeneo in der gleichnamigen Mozart-Oper und der Lohengrin. 1956 trat er am Teatro San Carlo Neapel in der Uraufführung der Oper »La Guerra« von Renzo Rossellini auf. Er starb 2009 in Sydney.
Sein Tenor ist uns durch Aufnahmen auf Orbis und Vox sowie durch eine integrale Aufnahme der Oper »Adriana Lecouvreur« von Cilea auf Colosseum erhalten. Auf Melodram singt er in der Oper »Il Furioso all‘ Isola di San Domingo« von Donizetti.
5.12. Vítězslav NOVÁK: 150. Geburtstag
Der Sohn eines Arztes studierte Rechtswissenschaften an der tschechischen Karls-Universität Prag und nahm gleichzeitig 1891-96 eine musikalische Ausbildung am Prager Konservatorium als Schüler von Josef Jiránek, Karel Stecker und Antonin Dvorák, wurde dort 1909-39 Professor für Kompositionslehre und war 1920-22 und 1927-28 dessen Rektor. Sein kompositorisches Werk stand zu Beginn und in den 1930er Jahren unter dem Einfluss der tschechischen Volksmusik, während er sich in den 1920er Jahren intensiv mit der westeuropäischen Musik auseinandersetzte. Als Komponist erreichte er internationales Ansehen und wirkte als Pädagoge nachhaltig auf die kommenden Generationen Prager Musiker. Stefanija Turkewytsch hat bei ihm studiert. Novák komponierte mehrere sinfonische Dichtungen, eine Suite, Serenaden, Ouvertüren, vier Opern, zwei Ballette, Chorkantaten, kammermusikalische Werke, Klavierstücke und Lieder. Er wurde 1928 Ehrendoktor der Comenius-Universität Bratislava, war seit 1905 korrespondierendes, seit 1922 ordentliches Mitglied in der Tschechischen Akademie der Wissenschaften und wurde 1945 mit dem Titel Nationalkünstler der Tschechoslowakei ausgezeichnet. 1947 wurde Novák zum Ehrenmitglied der International Society for Contemporary Music ISCM gewählt. Er starb 1949 in Skuteč (Tschechoslowakei). – Bei Vítězslav Novák kommt es vereinzelt zu Verwechslungen mit dem kroatischen Schriftsteller und Musikpädagogen Vjenceslav Novák.
6.12. Hanns-Martin SCHNEIDT: 90. Geburtstag
Seine Kindheit verlebte er in Leipzig. 1940 wurde er Mitglied des Thomanerchores der Thomasschule und Schüler von Thomaskantor Günther Ramin. Sein weiteres Musikstudium absolvierte er 1949-52 an der Münchner Musikhochschule. Noch während seines Studiums begann er als Chorleiter und Organist an der Münchner Erlöserkirche zu arbeiten. 1954 gewann er den Richard-Strauss-Preis der Stadt München. Im Jahre 1955 berief man den gerade erst 25 Jahre alten Schneidt zum Direktor der Kirchenmusikschule in Berlin. 1961–63 leitete er das von ihm gegründete Bach-Collegium und den Bach-Chor an der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche. Danach wechselte er nach Hamburg und lehrte 1971-78 als Professor an der dortigen Musikhochschule. 1963–85 war Schneidt GMD des Sinfonieorchesters Wuppertal. 1984-2001 war er als Nachfolger des 1981 verstorbenen Karl Richter Künstlerischer Leiter des Münchener Bach-Chores, ab 1985 zugleich auch Professor für Orchesterleitung und Kirchenmusik an der Hochschule für Musik und Theater München. 2001 erhielt er den Bayerischen Verdienstorden. Hanns-Martin Schneidt arbeitete immer wieder mit vielen deutschen Sinfonieorchestern als Gastdirigent, unter anderem mit den Berliner Philharmonikern, den Münchner Philharmonikern oder dem Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin (RSB). Eine umfangreiche Diskografie zeugt von seinem langjährigen künstlerischen Schaffen. Er starb 2018 bei München.
6.12. William HERBERT: 100. Geburtstag
Sein Vater stammte aus Wales, er hatte acht Geschwister. Er war in Melbourne Schüler des Pädagogen. A.E. Floyd. Er trat (angeblich) 1938 erstmals als Solist im »Messias« von Händel mit dem Victorian Symphony Orchestra, dann im gleichen Oratorium mit der Melbourne Philharmonic Society, auf. Er gab weitere Konzerte in den australischen Großstädten und im dortigen Rundfunk ABC, ging aber 1947 nach England. Hier entwickelte er eine große Karriere im Bereich des Konzert- und namentlich des Oratoriengesangs. Seine ersten Erfolge in England hatte er bei den Promenade Concerts in der Londoner Albert Hall und im englischen Rundfunk BBC. Bei seinen Auftritten in Oratorien (»The Dream of Gerontius« von E. Elgar, »Die Schöpfung« von Haydn, 9. Sinfonie von Beethoven, Werke von Händel, J.S. Bach und Monteverdi, von Mozart und Mendelssohn) trat er oft zusammen mit der berühmten englischen Altistin Kathleen Ferrier auf. Als seine große Partie galt der Evangelist in der Matthäuspassion von J.S. Bach. Er sang beim Three Choirs Festival und beim Festival von Edinburgh, bei den Musikfesten von Cambridge, Canterbury, Leeds und Norwich und 1951 während des Festival of Britain im Eröffnungskonzert in der Royal Festival Hall London. Er gastierte in den Konzertsälen in Holland, Belgien und Dänemark, in Spanien und in der Schweiz; hier sang er 1958 in einem weltweit ausgestrahlten Radiokonzert am Sitz der UN in Genf. 1950, 1955 und 1959 bereiste er Australien und Neuseeland in sehr erfolgreichen Konzert-Tourneen. 1963 folgte er einem Ruf als Professor an die University of Western Australia in Perth, trat aber auch noch während seiner Lehrtätigkeit im Konzertsaal auf. Er starb 1975 in Canberra.
Schallplatten: Nixa (»Der Messias« von Händel), Decca (Kantaten von J.S. Bach), London (»Semele« von Händel, 1955), L’Oiseau Lyre, Concert Hall/Westminster.
6.12. Elsie GRIFFIN: 125. Geburtstag

Sie wurde 1919 Mitglied der D’Oily Carte Opera Company, bei der sie vor allem in Operetten von Gilbert & Sullivan auftrat. Bis 1927 war sie bei dieser Gesellschaft im Engagement und gab danach zahlreiche Gastspiele an englischen Bühnen. Vor allem hörte man sie bei der Carl Rosa Company in Partien wie der Marguerite im »Faust« von Gounod, der Juliette in »Roméo et Juliette«, der Adina in »L‘Elisir d’amore« und der Micaela in »Carmen«. Sie starb 1989 in London. Sie war verheiratet mit dem Bariton Ivan Menzies (1896-1985).
Von ihrer Stimme existieren Operetten-Aufnahmen auf HMV aus den zwanziger Jahren (Werke von Gilbert & Sullivan wie »The Mikado«, »The Pirates of Penzance«, »HMS Pinafore«).
7.12. Seymour SCHWARTZMAN: 90. Geburtstag

Seit 1954 wirkte er als Kantor an einer Synagoge in Philadelphia. Die Schulung seiner Stimme erfolgte am Hebrew Union College und an der Academy of Vocal Arts & Temple University Philadelphia. 1964 betrat er erstmals die Bühne, und zwar sang er an der Oper von Philadelphia den Sonora in Puccinis »La Fanciulla del West«. 1966 erster Preisträger bei Gesangwettbewerben der Illinois Opera Guild und in Cincinnati. Er sang an den großen nordamerikanischen Operntheatern: in Pittsburgh, St. Paul, San Francisco (1967-69 den Germont in »La Traviata«, den Tonio im »Bajazzo«, den Rigoletto und den John Sorel in Menottis »The Consul«), Newark, New Orleans, Cincinnati, Houston (Texas), Minneapolis, Hartford, San Diego, an der New York City Opera, namentlich aber an der Oper von Philadelphia. Sein Repertoire enthielt vor allem dramatische Partien: den Amonasro in »Aida«, den Grafen Luna im »Troubadour«, den Renato im »Maskenball«, den Titelhelden in »Der fliegende Holländer«, den Escamillo in »Carmen«, den Enrico in »Lucia di Lammermoor«, den Talbot in »Maria Stuarda« von Donizetti, die vier Dämonen in »Hoffmanns Erzählungen«, den Scarpia in »Tosca«, den Michele in Puccinis »Il Tabarro«, den Rabbi David in »L’Amico Fritz« von Mascagni und den Alfio in »Cavalleria rusticana«. Auch als Konzertsänger, vor allem als Interpret jüdischer religiöser Vokalwerke, bekannt geworden. Er starb 2009 in Plantation (Florida).
Schallplatten: ANNA-Records (vollständige Oper »Risurrezione« von Alfano).
7.12. Karl Anton ECKERT: 200. Geburtstag
Früh verwaist, wurde er von dem Dichter Friedrich Christoph Förster adoptiert. Bereits um 1825 machte Eckert als musikalisches Wunderkind von sich reden. Förster ermöglichte ihm eine umfassende musikalische Ausbildung im Klavier-, Violin- und Hornspiel u. a. bei Karl Wilhelm Greulich, F. Bötticher und Hubert Ries sowie in Komposition bei Carl Friedrich Zelter und Carl Friedrich Rungenhagen. Zelter war auf Eckert aufmerksam geworden und holte ihn 1832 als Altist in die Sing-Akademie. Rungenhagen war von Eckert ebenfalls begeistert und nahm ihn als Schüler, später auch Mendelssohn in Leipzig, bei dem er seine Studien abschloss. Unterstützt und gefördert von Zelter konnte Eckert bereits im Herbst 1832 mit einem Solokonzert als Pianist debütieren. 1830 trat er als Komponist mit der Oper Das Fischermädchen und 1833 als gerade einmal 13-Jähriger als Dirigent mit seinem eigenen Oratorium Ruth mit der Sing-Akademie an die Öffentlichkeit. Zwei Jahre darauf gab er sein erstes Konzert als Violinist. Mitte der 1840er Jahre gehörte Eckert in Rom zu einem Künstlerkreis um Ludwig Landsberg, Eduard Franck und Théodore Gouvy. Später berief man ihn als Kapellmeister an die Königliche Hofoper, ein Amt, welches er bis zum Frühjahr 1848 innehatte. Während der Märzrevolution 1848 verließ Eckert Hals über Kopf Berlin und emigrierte nach Amsterdam, später nach Brüssel. Anlässlich eines Konzerts in Paris lernte Eckert 1850 die Sängerin Henriette Sontag nebst ihrem Ehemann, dem Diplomaten Carlo Rossi kennen. Im darauffolgenden Jahr begleitete Eckert Sontag auf deren Tournee durch die USA, auf der die Sängerin an ihre früheren Erfolge anknüpfen konnte. 1853 kehrte Eckert nach Europa zurück. Er wurde 1853 Dirigent am Theater am Kärtnertor in Wien und war 1858-60 dessen Direktor. Unter seiner Leitung bildeten die Erstaufführungen von Wagners Lohengrin (1858) und Tannhäuser (1859) die herausragenden Ereignisse. Danach war er Hofkapellmeister in Stuttgart. Wilhelm I., der König von Preußen, berief Eckert 1868 wieder an die Königliche Hofoper in Berlin wo er bis 1879 als Hofkapellmeister arbeitete. Zudem war er 1875-79 Mitglied der Preußischen Akademie der Künste, Berlin, Sektion für Musik. Neben seinen offiziellen Aufgaben an der Hofoper schuf Eckert ein kleines eigenes kompositorisches Werk und bearbeitete einige Werke früherer Musiker. Als enger Freund Richard Wagners, war es Eckerts Verdienst, mehrere Werke Wagners in Berlin zur Uraufführung gebracht zu haben. Im Alter von 58 Jahren starb Karl Anton Eckert 1879 in Berlin. Im Jahr 1875 wurde in Wien-Favoriten (10. Bezirk) die Eckertgasse nach ihm benannt.
8.12. Jayne CASSELMAN: 65. Geburtstag

Ihre Mutter war Dirigentin eines Kirchenchores in den USA. Sie studierte Musik an der Universität von Kansas City und ließ ihre Stimme durch die Pädagogin Inci Bashar ausbilden. 1984 kam sie nach Deutschland, und zwar als Lehrerin an eine Musical-Schule in Hamburg. 1984 wurde sie an das Pfalztheater in Kaiserslautern verpflichtet, dessen Mitglied sie für neun Jahre, bis 1993, blieb. Sie sang dort eine Vielzahl von Partien, darunter die Dorabella in »Così fan tutte«, den Hänsel in »Hänsel und Gretel«, den Orpheus von Gluck, die Frau Reich in Nicolais »Die lustigen Weiber von Windsor«, den Orlofsky in der »Fledermaus«, die Carmen, die Cenerentola von Rossini, die Charlotte im »Werther« von Massenet, die Nancy in »Albert Herring« von B. Britten, die Concepcion in »L’Heure espagnole« von Ravel und die Marina im »Boris Godunow«. Sie wechselte dann allmählich vom Mezzosopran- ins Sopranfach und sang jetzt die Alice Ford im »Falstaff« von Verdi, die Tatjana im »Eugen Onegin« und die Titelrolle in »Vanessa« von S. Barber. 1993-95 war sie Mitglied des Staatstheaters Kassel; hier übernahm sie jetzt Partien wie die Senta in »Der fliegende Holländer«, die Agathe im »Freischütz«, die Butterfly, die Mathilde in »Enrico« von Manfred Trojahn, die Salome von R. Strauss und die Sieglinde in der »Walküre«. 1995 wurde sie an das Opernhaus von Dortmund verpflichtet, an dem sie als Kundry im »Parsifal«, als Rachel in »La Juive« von Halévy, als Cassandre wie als Didon in »Les Troyens« von Berlioz und als Leonore in Verdis »La forza del destino« ihre Erfolge hatte. 1997 gastierte sie am Nationaltheater Mannheim wie an der Deutschen Oper am Rhein Düsseldorf-Duisburg als Kundry und als Salome, am Staatstheater Darmstadt als Senta wie als Leonore im »Fidelio«, 1997 im Palacio de las Bellas Artes in Mexico City (wie zuvor in Berlin und Leipzig) in den »Gurreliedern« von A. Schönberg. Am Opernhaus der Stadt Bonn hörte man sie 1997-98 als Brünnhilde in der »Walküre« und in der Titelrolle der Oper »Lady Macbeth von Mzensk« von Schostakowitsch. 1999 sang sie am Staatstheater von Karlsruhe die Els im »Schatzgräber« von Franz Schreker, am Opernhaus der Stadt Bonn die Brünnhilde im »Siegfried«, am Nationaltheater Mannheim 1999 die Brünnhilde in der »Walküre«, 2000 auch im »Siegfried«. 2000 trat sie am Staatstheater Karlsruhe als Isolde in »Tristan und Isolde«, an der Oper von Philadelphia als Salome von R. Strauss, am Nationaltheater Mannheim jetzt als Brünnhilde in der »Götterdämmerung« auf. 2011 sang sie bei den Wagner Festspielen von Wels die Isolde. Die Künstlerin lebte in Deutschland, widmete sich auch der Weiterbildung junger Künstler und richtete zu diesem Zweck den Kulturhof Huthmacher in Dierbach ein. Als sie an ALS erkrankte und die Krankheit sie immer mehr einschränkte, kehrte sie in ihre Heimat zurück, wo sie 2016 in Phoenix im Alter von 60 Jahren an den Folgen der Krankheit verstarb.
8.12. Jaroslav SOUČEK: 85. Geburtstag
Biographie des tschechischen Baritons auf Englisch: https://en.wikipedia.org/wiki/Jaroslav_Sou%C4%8Dek
9.12. Christina CARROLL: 100. Geburtstag

Ihre Familie verzog von Rumänien nach Nordamerika, wo sie ihre Erziehung und ihre musikalische Ausbildung erhielt. 1941 debütierte sie in St. Louis als Philine in »Mignon« von A. Thomas. 1941-42 gastierte sie an der San Francisco Opera als Poussette in »Manon« von Massenet, als Hirtenknabe im »Tannhäuser«, als Mercédès in »Carmen« und als Ida in der »Fledermaus«. 1943 kam sie bereits an die New Yorker Metropolitan Oper, der sie bis 1946 angehörte. Sie debütierte dort als Musetta in »La Bohème« und trat dann in insgesamt 32 Vorstellungen auch als Micaela in »Carmen«, als Page Oscar in Verdis »Un ballo in maschera«, als Blumenmädchen im »Parsifal«, als Barbarina in »Le nozze di Figaro« und mehrfach in Konzerten auf. Sie gastierte an der City Opera New York 1949 als Sophie im »Rosenkavalier«, auch in Los Angeles. In den Jahren 1947-48 war sie hauptsächlich an italienischen Operntheatern zu Gast, u.a. am Teatro Comunale Florenz (1949 als Marguerite im »Faust« von Gounod), am Teatro San Carlo in Neapel und am Teatro Fenice Venedig. Im Sommer 1948 gastierte sie mit dem Ensemble des Glyndebourne Festivals beim Festival von Edinburgh als Donna Elvira im »Don Giovanni«, 1951 gastierte sie in Rio de Janeiro. Mit ihrem technisch vorzüglich durchgebildeten Koloratursopran beherrschte sie ein umfangreiches Opern- und Konzertrepertoire. Sie starb 1990 in Scottsdale (Arizona).
Schallplatten: eine Remington-Platte (1949).
9.12. Conchita SUPERVIA: 125. Geburtstag

Sie stammte aus einer alten andalusischen Familie; ihr eigentlicher Name war Concepción Supervia Pascual. Sie kam mit zwölf Jahren auf das Conservatorio del Liceu Barcelona, wo sie bei den Pädagogen Goula und Ferrer studierte. Sie debütierte 1910 in Buenos Aires mit einer reisenden spanischen Operntruppe in der Oper »Bianca di Beaulieu« von Cesar Stiattesi und in der Zarzuela »Los amantes de Teruel« von Breton. 1911 kam sie in Italien zu ihren ersten Erfolgen, als sie am Teatro Petruzzelli in Bari, damals 16 Jahre alt, als Carmen auftrat. 1911 sang sie in der italienischen Erstaufführung des »Rosenkavalier« von R. Strauss am Teatro Costanzi in Rom als Partnerin von Hariclea Darclée den Octavian. 1912 bewunderte man sie an der Oper von Bologna als Carmen und als Dalila in »Samson et Dalila« von Saint-Saëns; 1914 hatte sie glänzende Erfolge an der Oper von Havanna und am Gran Teatre del Liceu in Barcelona. 1915-16 war sie Mitglied der Oper von Chicago, wo sie als Charlotte im »Werther« von Massenet, als Carmen und als Mignon ihr Publikum begeisterte. Seit 1920 sang sie hauptsächlich an den großen italienischen Bühnen (Teatro Grande Brescia, Teatro Carlo Felice Genua, Teatro Donizetti Bergamo, Teatro Verdi Ferrara) und in Barcelona. Seit 1924 war sie an der Mailänder Scala sehr erfolgreich. Als Antrittsrolle sang sie dort den Hänsel in »Hänsel und Gretel« von Humperdinck mit Ines Maria Ferraris als Partnerin; später feierte man sie dort als Octavian und als Cherubino in »Le nozze di Figaro«. 1926 kreierte sie in einem Konzert an der Scala de Fallas »El amor brujo« für Italien. An der Scala kreierte sie auch 1929 die Concepcion in der Erstaufführung von Ravels »L’Heure espagnole«. 1925 begann sie in Turin mit der Neu-Belebung der Belcanto-Opern von Rossini (»L’Italiana in Algeri«, »La Cenerentola«, »Barbier von Sevilla« in der Original-Form mit der Rosina als Alt-Partie), die hauptsächlich deshalb nicht mehr aufgeführt wurden, weil die enormen technischen Schwierigkeiten ihrer Koloratur-Contralto-Rollen von den Altistinnen des 20. Jahrhunderts nicht gemeistert werden konnten. Mit Hilfe ihrer phänomenalen Gesangtechnik erregte Conchita Supervia in diesen Opern 1925 zuerst am Teatro di Torino von Turin, dann in Florenz, Rom, London, Paris und in Südamerika größtes Aufsehen. So sang sie u.a. die Isabella in »L’Italiana in Algeri« in Turin, Madrid, Barcelona, Rom, Paris (Théâtre des Champs Elysées, 1930) und 1935 an der Covent Garden Oper London, »La Cenerentola« in Turin, Paris, beim Maggio Musicale von Florenz 1933 und 1934 an der Covent Garden Oper. 1927 sang sie in Turin in der Uraufführung der Oper »Fata malerba« von Vittorio Gui, 1932 an der Opéra-Comique Paris die Titelrolle in der Lehár-Operette »Frasquita«; 1934 wirkte sie in dem englischen Film »Evensong« mit. 1931 heiratete sie den englischen Industriellen Ben Rubenstein und verlegte nun ihren Wohnsitz nach London. 1935 gab sie ihr letztes Konzert in Kopenhagen. Sie starb 1936 im Alter von 40 Jahren in London nach der Geburt eines Kindes. Altstimme von besonderer Schönheit; in der Gesangtechnik von größter Virtuosität, im Vortrag sich bis zu dramatischer Leidenschaftlichkeit steigernd. Ihre aparte, typisch spanische Erscheinung auf der Bühne und ihr charmantes, temperamentvolles Spieltalent ergänzten glücklich die Qualität ihrer Stimme. Große Interpretin des spanischen Liedes und der Zarzuela.
Lit: J. Newton: Conchita Supervia (in »Recorded Sound«, 1973).
Zahlreiche (über 200) schöne Aufnahmen auf Parlophon und Ultraphon, 1927-33 entstanden.
10.12. Edmond HURSHELL: 100. Geburtstag
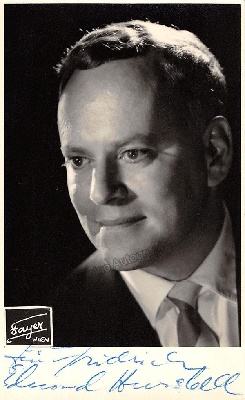
Er erhielt seine Ausbildung in seiner amerikanischen Heimat und begann seine Karriere in den USA. Er kam dann zu weiteren Studien nach Deutschland und war dort 1952-53 an der Städtischen Oper Berlin engagiert, 1953-55 am Stadttheater von Kiel. Nach einem erfolgreichen Gastspiel 1955 (mit den vier Dämonen in »Hoffmanns Erzählungen«) wurde er an die Staatsoper von Wien verpflichtet, deren Mitglied er bis 1960 blieb. Hier sang er den Hans Sachs in »Die Meistersinger von Nürnberg«, den Don Pizarro im »Fidelio«, den Amonasro in »Aida«, den Großinquisitor im »Don Carlos«, den Orest in »Elektra«, den Galitzky in »Fürst Igor« von Borodin, den Geisterboten in »Die Frau ohne Schatten« von R. Strauss, den Scarpia in »Tosca«, den Biterolf im »Tannhäuser«, den Ercole Severolus in »Palestrina« von Pfitzner, den Kurwenal in »Tristan und Isolde«, den Pommersfelden in »Mathis der Maler« von Hindemith, den Achillas in » Giulio Cesare « von Händel, den Alfio in »Cavalleria rusticana«, den Kerkermeister in Poulencs »Gespräche der Karmeliterinnen«, den Monterone im »Rigoletto«, den Mandryka in »Arabella« von R. Strauss, einen der Priester in Pizzettis »Mord in der Kathedrale« und den Roucher in »Andrea Chénier« von Giordano. Er gastierte 1956 am Stadttheater (Opernhaus) von Zürich als Hans Sachs, 1961 als Fliegender Holländer. Nach 1960 trat er nur noch als Gast auf; so sang er 1961 am Théâtre de la Monnaie Brüssel die vier Dämonen in »Hoffmanns Erzählungen«, am Teatro Fenice Venedig 1961 den Jochanaan in »Salome« von R. Strauss, am Teatro Comunale Bologna 1963 den Wolfram im »Tannhäuser«, in Amsterdam 1963 den Wotan in der »Walküre«, am Gran Teatro del Liceu in Barcelona 1964 die Titelpartie in »Giulio Cesare« von Händel, am Teatro Colón Buenos Aires 1965 den Fliegenden Holländer und an der Oper von Lille 1965 den Wanderer im »Siegfried«. Weitere Gastspiele am Staatstheater Hannover (1961), am Opernhaus von Nürnberg (1963), am Stadttheater von Basel (1964), in Rom, Genua, Tel-Aviv, Athen und Philadelphia. In der Spielzeit 1966-67 sang er an der Metropolitan Oper New York in insgesamt drei Vorstellungen den Kurwenal und den Telramund im »Lohengrin«. 1967-69 war er dem Opernhaus von Graz durch einen Gastvertrag verbunden. Aus seinem Bühnenrepertoire sind noch der Kaspar im »Freischütz« und der Titelheld im »Falstaff« von Verdi nachzutragen. Er starb 1993 in Portland (Oregon). – Seine Gattin, die Sopranistin Patricia Cullen, war u.a. am Stadttheater von Kiel und am Opernhaus von Köln engagiert und sang Partien wie die Donna Anna im »Don Giovanni«, die Margiana im »Barbier von Bagdad« von P. Cornelius und die Titelfigur in »Salome« von R. Strauss.
Von der Stimme des Sängers existieren Schallplatten bei Morgan (Roucher in »Andrea Chénier« von Giordano, Mitschnitt einer Aufführung der Wiener Staatsoper von 1960) und Vox (»Cantata Profana« von B. Bartók) sowie DGG (»Mord in der Kathedrale« von I. Pizzetti).
11.12. Bette BJÖRLING: 95. Geburtstag

Sie stammte aus einer schwedischen Familie, die in den USA lebte; ihr eigentlicher Name war Bette Wermine, unter dem sie auch anfänglich in Stockholm auftrat. Gesangstudium an der Juillard School of Music sowie bei der berühmten schwedischen Sängerin Karin Branzell in New York. Sie kam dann nach Schweden und debütierte 1947 an der Königlichen Oper Stockholm als Amneris unter dem Künstlernamen Kristine Lindberg. 1951 heiratete sie den Tenor Gösta Björling (1912-57), der gleichfalls an der Stockholmer Oper wirkte, und sang seither unter dem Namen Bette Björling. Bis 1956 blieb sie Mitglied der Königlichen Oper Stockholm, gab Gastspiele, war aber auch auf dem Gebiet des Konzertgesangs erfolgreich. Sie wirkte u.a. 1952 in Stockholm in der schwedischen Erstaufführung der Oper »The Consul« von Gian Carlo Menotti in der Rolle der Vera mit. Sie starb 2003 in Lexington Place (Maryland).
Von der Stimme der Sängerin existiert eine Aufnahme auf HMV, auf Blue Bell wurden Überspielungen von Auftritten publiziert.
13.12. Maria VERHAERT: 95. Geburtstag
Biographie der belgischen Mezzosopranistin auf Holländisch: https://operanederland.nl/2014/03/30/mezzosopraan-maria-verhaert-overleden/
13.12. Hella RUTTKOWSKI: 100. Geburtstag
Sie wurde am Konservatorium von Nürnberg sowie durch die Pädagogin Julie Schützendorf-Koerner ausgebildet. 1944 debütierte sie am Stadttheater von Nürnberg. Sie blieb diesem Haus bis zu ihrem Abschied 1980 als Mitglied verbunden. Sie sang in dieser langen Zeit hier eine Fülle von Rollen aus den unterschiedlichsten Fachbereichen wie den Cherubino in »Figaros Hochzeit«, die Dorabella in »Così fan tutte«, die Frau Reich in Nicolais »Die lustigen Weiber von Windsor«, die Mary in »Der fliegende Holländer«, die Maria von Magdala in »Die toten Augen« von E. d’Albert, den Hänsel in »Hänsel und Gretel«, die Amneris in »Aida«, die Mariana in »Die vier Grobiane« von E. Wolf-Ferrari, die Carmen, die Mignon von A. Thomas, die Hexe in »Rusalka« von Dvorák und die Marina im »Boris Godunow«. 1962 wirkte sie in Nürnberg in der Uraufführung von Mark Lothars Oper »Der Glücksfischer« mit. 1963 Gastspiel am Teatro Comunale Florenz. Sie hatte auch als Konzertsängerin eine Karriere von Bedeutung. Sie starb 2008 in Nürnberg. Sie war verheiratet mit dem Schauspieler Hans Friedrich Rüssel († 1974).
13.12. Primo MONTANARI: 125. Geburtstag
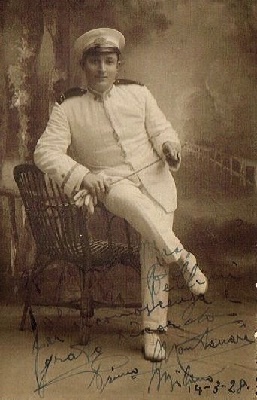
Als er vierzehn Jahre alt war, wanderte seine Familie nach Nordamerika aus. Er absolvierte dort sein Gesangstudium in Boston, kam aber während des Ersten Weltkrieges nach Italien zurück und debütierte 1918 in Savona in »Lucia di Lammermoor«. Er trat 1923 am Teatro Regio Turin als italienischer Sänger im »Rosenkavalier« und als Arturo in »Lucia di Lammermoor« auf. Er trat in der Folgezeit an den großen italienischen Bühnen auf. Er war 1929-30 bei der Italienischen Oper in Holland engagiert, wo er den Herzog im »Rigoletto«, den Edgardo in »Lucia di Lammermoor«, den Alfredo in »La Traviata«, den Grafen Almaviva im »Barbier von Sevilla« und den Luigi in »Il Tabarro« von Puccini sang. Zu seinen großen Rollen gehörte auch der Elvino in Bellinis »La Sonnambula«. 1932 nahm er an einer Australien-Tournee mit der Imperial Opera Company teil, 1936 sang er am Teatro Comunale Mantua den Edgardo, 1937 am Teatro Civico Cagliari den Fenton im »Falstaff« von Verdi. 1927 und 1939 gastierte er am Teatro Carelo Felice Genua, 1938 am Teatro Politeama Genua. Er setzte seine Karriere bis in der vierziger Jahre fort. 1927 heiratete er die große Primadonna Lina Pagliughi (1907-80) und sang jetzt oft zusammen mit dieser, so u.a. 1929-30 bei der Italienischen Oper in Holland. Nach Beendigung seiner Bühnenlaufbahn unterrichtete er, zum Teil gemeinsam mit seiner Gattin, in einer Gesangschule in Mailand, später in der Villa des Ehepaars in seinem Geburtsort Gatteo (Romagna). Er starb 1972 in Cesenatico bei Rimini.
Schallplatten: Einige Aufnahmen auf HMV, hauptsächlich Romanzen und italienische Lieder, auch auf Fonit vertreten.
13.12. Alfred SIEDER: 150. Geburtstag
Er erhielt zuerst eine Ausbildung als Maler. Seine schöne Stimme fiel bei einer Dilettantenaufführung auf, worauf er diese durch den Pädagogen Karl Ohnesorg ausbilden ließ. 1894 erfolgte sein Bühnendebüt am Stadttheater von Königsberg (Ostpreußen). In der folgenden Spielzeit 1895-96 sang er am Stadttheater von Colmar (Elsass), dann in den Jahren 1896-99 am Stadttheater von Basel. 1899-1903 war er Mitglied des Opernhauses von Köln, danach bis 1909 des Hoftheaters Mannheim. Er lebte darauf in Berlin und gab Gastspiele; er beteiligte sich von dort aus auch an einer Operetten-Tournee durch Südamerika. Im Mittelpunkt seines Repertoire standen vor allem Buffo-Rollen (Basilio in »Figaros Hochzeit«, Georg im »Waffenschmied« von Lortzing, Barbarino in Flotows »Alessandro Stradella«, Mime im Nibelungenring, David in »Die Meistersinger von Nürnberg«). Eine seiner bedeutendsten Leistungen entwickelte er in der Partie des Waldschratts in der damals viel gespielten Oper »Die versunkene Glocke« von Heinrich Zöllner, den er auch 1899 in der Uraufführung der Oper am Berliner Theater des Westens gesungen hatte. In seinem Repertoire war dazu eine Reihe von Operettenpartien anzutreffen.
13.12. Gottfried WEISS: 200. Geburtstag
Er erhielt ersten Unterricht in Klavier-, Orgel- und Violinspiel durch seinen Vater, der Kantor und Lehrer war. Auch er sollte Lehrer werden und besuchte das Lehrerseminar in Breslau. Dort erkannte man jedoch seine musikalische Begabung und schickte ihn 1841 zur Ausbildung nach Berlin. Er studierte in Berlin 1841-44 Violine und Komposition bei Marx und bei dem Konzertmeister Riess und war seit 1845 als Musikkritiker der damaligen Berliner Staatszeitung, der Leipziger Neuen Musikzeitung und der Leipziger Illustrierten Zeitung tätig. Er kam in Kontakt mit dem Gesangsmethodiker Christian Gottfried Nehrlich, für dessen System der Gesangtheorie er sich interessierte, und unternahm große Vortragsreisen. Gleichzeitig war er als Komponist tätig und vollendete 1847 in Wien eine historische Oper »Heinrich, Mönch von Landskron«, aus der einige Nummern 1848 bei einem Konzert in Berlin aufgeführt wurden. 1849 erfolgte sein Debüt als Sänger, als er am Theater von Potsdam den Médor in »Cinderelle« von Isouard und den Conte Rodolfo in Bellinis »La Sonnambula« sang. Er fand jedoch seine Stimme noch nicht vollkommen ausgebildet und reiste mit Nehrlich nach Paris (1850), dann nach London, wo er den großen Sänger Luigi Lablache kennenlernte. 1850-52 sang er wieder in Wien, dann in Köln und Göttingen Partien wie den Titelhelden in »Belisario« von Donizetti, den Duca in »Lucrezia Borgia« vom gleichen Komponisten, den Figaro im »Barbier von Sevilla« und den Nevers in Meyerbeers »Hugenotten«. 1853 hielt er in Hamburg Vorlesungen über »Die Grundzüge einer wahrhaft naturgemäßen Methode des Studiums der Gesangskunst, sowie die Darstellung dieses Studiums als Erziehungs- und Heilmittel für’s Menschenwesen«. Er blieb für längere Zeit in Hamburg als Gesanglehrer tätig, verlegte aber 1856 seine Tätigkeit nach Berlin. Dort war er seit 1858 Gesanglehrer am Joachimsthal’schen Gymnasium. Zu seinen Schülerinnen zählte die Konzertsängerin Helene Valentin. Unter seinen Kompositionen finden sich neben der bereits erwähnten Oper vor allem Lieder. Er starb 1897 in Berlin.
14.12. Rosanna CARTERI: 90. Geburtstag
Ihre musikalische Begabung zeigte sich sehr früh. Bereits mit zwölf Jahren gab sie ein aufsehenerregendes Konzert. Sie studierte bei Cusinati, auch bei Nino Ederle, und gewann 1948 einen Gesangwettbewerb des italienischen Rundfunks. 1949 debütierte sie auf der Bühne, und zwar bei den Festspielen in den Thermen des Caracalla in Rom als Elsa im »Lohengrin«. Es folgte eine Gastspielreise durch Spanien, dann Engagements an den großen italienischen Theatern. Vor allem war sie seit 1951 an der Mailänder Scala erfolgreich. Ihr Debüt an der Scala erfolgte als Cecchina in der Oper »La buona figliola« von Piccinni. An diesem Haus sang sie dann 1952 die Nannetta in Verdis »Falstaff«, 1952, 1955 und 1959 die Mimì in »La Bohème«, 1953 die Manon von Massenet und die Gilda im »Rigoletto«, 1954 die Lucieta in »I quatro rusteghi« von E. Wolf-Ferrari, 1954 und 1956-57 die Adina in »L’Elisir d‘amore«, 1955 die Micaela in »Carmen«, die Silvia in »Zanetto« von Mascagni und die Parasja in »Der Jahrmarkt von Sorotschinzy« von Mussorgsky, 1956 die Zerlina im »Don Giovanni« sowie 1958 und 1962 die Liù in Puccinis »Turandot«. Sie wirkte hier auch in mehreren Uraufführungen mit: am 17.3.1952 als Flavia in » Proserpina e lo straniero « von Juan José Castro, am 23.3.1961 als Metarosa in »Il calzare d‘argento« von Ildebrando Pizzetti und am 8.2.1963 als Donna Rosita in »Il linguaggio die fiori« von Renzo Rossellini. Sie gehörte zu den bedeutendsten italienischen Konzertsopranistinnen ihrer Generation; so sang sie oft bei den Konzertveranstaltungen der Accademia di Santa Cecilia in Rom unter Francesco Molinari-Pradelli und wirkte in Neapel in einer wichtigen Aufführung des Requiems von Donizetti mit. 1952 sang sie bei den Festwochen von Zürich die Nannetta, 1952 bei den Salzburger Festspielen die Desdemona im »Otello« von Verdi unter W. Furtwängler, 1953 beim Maggio Musicale von Florenz die Natascha in »Krieg und Frieden« von Prokofjew, 1958-59 bei den Festspielen von Verona. An der Oper von San Francisco gastierte sie 1954-55 als Mimì, als Susanna in »Le nozze di Figaro«, als Donna Gabriela in der amerikanischen Erstaufführung von Cherubinis »L’Hôtellerie portugaise«, als Manon von Massenet, als Micaela, als Zerlina und als Marguerite im »Faust« von Gounod. 1960 erschien sie als Mimi an der Covent Garden Oper London. 1955 an der Chicago Opera als Marguerite im »Faust« von Gounod, 1964 an der Wiener Staatsoper als Liù zu Gast. 1950 sang sie im italienischen Rundfunk die Titelpartie in der Uraufführung der Oper »Ifigenia« von Ildebrando Pizzetti, 1957 am Teatro San Carlo Neapel die Titelpartie in »Vivi« von Franco Mannino, 1961 am Teatro Comunale Florenz in »Il Mercante di Venezia« von M. Castelnuovo-Tedesco. Am 25.10.1962 wirkte sie am Théâtre des Champs Élysées Paris in der Uraufführung von Gilbert Bécauds »L’Opéra d’Aran« mit. Gastspiele und Konzerte trugen ihr in Spanien, England, Frankreich, in Nord- und Südamerika immer wieder Erfolge ein. Mitte der sechziger Jahre gab sie ihre Karriere auf. Sie starb am 25.10.2020 in Monte Carlo.
Ihre Schallplatten kamen auf RCA (»La Traviata«), Cetra (»Falstaff«, »Wilhelm Tell«, »Suor Angelica«, »La Bohème«) und auf Columbia (»La serva padrona«) heraus. Auf Fonit-Cetra singt sie das Solo im Deutschen Requiem von Brahms unter Bruno Walter (Rom, 1952). Auf der gleichen Marke in »I quattro rusteghi« von Wolf-Ferrari, auf Cetra Opera Live in »Carmen« und »Turandot«, auf EJS in »La donna del lago« von Rossini zu hören.
14.12. Ruggero BONDINO 90. Geburtstag
Nachdem er sich zuerst als Fußballspieler betätigt hatte, wurde seine Stimme durch Bruno Carmassi in Mailand und durch Luigi Ricci in Rom ausgebildet. Er debütierte 1957 am Teatro Nuovo in Mailand als Faust von Gounod. Er hatte eine sehr erfolgreiche Karriere an den großen italienischen Operntheatern, darunter an der Mailänder Scala (1967 Paco in »La vida breve« von M. de Falla), an der Oper von Rom, bei den Festspielen von Verona und in den Caracalla-Thermen in Rom. Für seine internationale Anerkennung sorgten Gastspiele an den Staatsopern von Wien (1966-78 als Pinkerton in »Madame Butterfly«, als Herzog im »Rigoletto«, als Alfredo in »La Traviata« und als Riccardo in Verdis »Maskenball« in insgesamt 10 Vorstellungen) und Stuttgart, an der Niederländischen Oper Amsterdam, am Gran Teatre del Liceu in Barcelona, am Teatro San Carlos Lissabon, an der Nationaloper von Belgrad, in Köln, Frankfurt a.M., Hannover, Marseille, Nancy, Toulouse, Genf (1964 als Rodolfo in »La Bohème«), Basel, bei der Welsh Opera Cardiff, in Kopenhagen, Rio de Janeiro und Toronto. Dabei trug er ein umfangreiches Repertoire vor, das Partien in Opern von Boito, Berlioz, Donizetti, Bellini, Giordano, Gounod, de Falla, Puccini, Verdi, Zandonai, Menotti und Aufgaben aus der zeitgenössischen Opernliteratur enthielt. 1961 sang er an der Oper von Rom in der Uraufführung von »Sguardo dal ponte« von Renzo Rossellini, am 1.3.1965 an der Mailänder Scala in »Clitennestra« von Ildebrando Pizzetti die Partie des Oreste. Er trat auch in mehreren Fernsehaufführungen von Opern in Erscheinung. Er starb 2019 in Lugano (Schweiz).
Schallplatten: RAI, TIS (»Roberto Devereux« von Donizetti), Rodolphe Records, Bongiovanni (»Nozze Istriane« und »Falena« von Smareglia); Privatmitschnitte von Opern (u.a. »Francesca da Rimini« von Zandonai, »La damnation de Faust« von Berlioz).
15.12. Rosl SEEGERS: 125. Geburtstag
Ihre Ausbildung zur Sängerin erfolgte im Wesentlichen am Stern’schen Konservatorium in Berlin. Nach dem Ende des Ersten Weltkrieges trat sie an verschiedenen Berliner Operettenbühnen in zahlreichen Partien aus dem Fachbereich der Soubrette auf. Daneben war sie in den dreißiger und vierziger Jahren eine sehr erfolgreiche Rundfunksängerin. Noch 1955 gastierte sie an der Städtischen Oper Berlin als Juno in der Offenbach-Operette »Orpheus in der Unterwelt«. Sie starb 1969 in Berlin.
Die Künstlerin hinterließ eine Vielzahl von Schallplattenaufnahmen auf verschiedenen Marken, u.a. auf Telefunken, Tempo (hier u.a. Duette mit Franz Klarwein), Polydor, HMV, Urania (Gesamtaufnahmen der Operetten »Tausendundeine Nacht« von Johann Strauß und »Zigeunerliebe« von F. Lehár).
16.12. Enid HARTLE: 85. Geburtstag
Biographie der englischen Mezzosopranistin auf Englisch: https://en.wikipedia.org/wiki/Enid_Hartle
16.12. Luigi MARLETTA: 125. Geburtstag

Er war zuerst Schüler von Maestro Vallaro in Casale Monferrato und studierte dann am Mailänder Konservatorium bei Vincenzo Pintorno. 1923 kam er zu einem großen Erfolg, als er am Teatro Carcano in Mailand den Manrico im »Troubadour« von Verdi sang. Während vieler Jahre trat er dann an den großen Opernbühnen der italienischen Halbinsel in Erscheinung: am Teatro Regio Turin, am Teatro Fenice Venedig, am Teatro San Carlo Neapel, am Teatro Carlo Felice Genua und am Teatro Massimo Palermo. Sehr große Erfolge erzielte er bei Gastspielen in Südamerika, namentlich in Rio de Janeiro und Buenos Aires. Er gastierte auch am Théâtre de la Monnaie Brüssel, am Royal Opera House Malta und nahm an den Gastspielreisen der Wanderoper Carro di Tespi Lirico durch Italien teil. Dirigenten wie Arturo Toscanini und Tullio Serafin schätzten sein Können hoch ein. Seine großen Bühnenpartien fanden sich im heldischen Tenorfach (Radames in »Aida«, Alvaro in »La forza del destino«, Arnoldo in Rossinis »Wilhelm Tell«, Vasco in Meyerbeers »Afrikanerin«). Er starb 2000 in Italien. Seit 1927 war er mit der Altistin Camilla Rota (1899-1977) verheiratet.
17.12. Edith CHMIEL: 80. Geburtstag
Sie erhielt ihre Ausbildung an der Musikhochschule ihrer Vaterstadt Dresden und war dann an den Theatern von Plauen und Dessau engagiert. Hier sang sie Partien wie die Pamina in der »Zauberflöte«, die Mimi in »La Bohème«, die Butterfly, die Gräfin in »Figaros Hochzeit«, die Zdenka in »Arabella« von R. Strauss und die Serena in »Porgy and Bess« von Gershwin. Seit 1979 war sie durch einen Gastvertrag dem Opernhaus von Leipzig verbunden und wurde dann dessen reguläres Mitglied. Hier hörte man sie als Eva in »Die Meistersinger von Nürnberg«, als Fiordiligi in »Così fan tutte«, als Ninetta in »Die Liebe zu den drei Orangen« von Prokofjew, als Butterfly, als Micaela in »Carmen« und als Antonia in »Hoffmanns Erzählungen«. Sie trat mit dem Ensemble des Leipziger Opernhauses bei Gastspielen in Italien, Frankreich und Spanien wie an der Oper von Monte Carlo auf und wurde auch als Konzertsolistin bekannt. Sie starb im März 2015.
17.12. Hugh BERESFORD: 95: Geburtstag
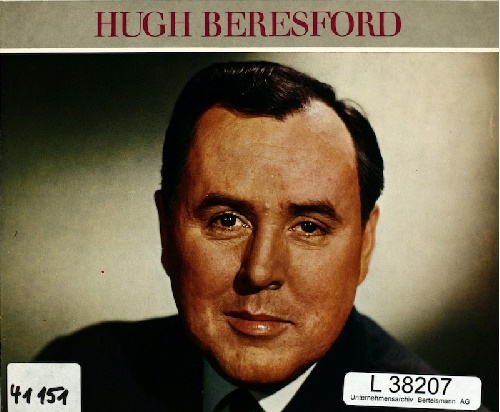
Er begann sein Gesangstudium am Royal College of Music in Manchester, kam dann an die Musikakademie von Wien und war in London, Mailand und Düsseldorf Schüler von Dino Borgioli, Alfred Piccaver, Melchiorre Luise, Francesco Carino und Wolfgang Steinbrueck. 1951 wurde er mit dem Richard Tauber-Preis ausgezeichnet. 1953 debütierte er (als Bariton) am Landestheater von Linz/Donau als Wolfram im »Tannhäuser«. Er sang dann an den Stadttheatern von Graz und Augsburg sowie 1958-60 am Opernhaus von Wuppertal. 1960 wurde er Mitglied der Deutschen Oper am Rhein Düsseldorf-Duisburg. Jetzt begann für den Künstler eine große internationale Karriere. Seit 1960 gastierte er mehrfach an der Londoner Covent Garden Oper, weitere Gastspiele führten ihn an die Staatsopern von Wien (1961-64 als Mandryka in »Arabella« von R. Strauss, 1973 als Florestan im »Fidelio«), München und Stuttgart, an die Opernhäuser von Frankfurt a.M. und Zürich und an die Grand Opéra Paris. 1963 und 1966 wirkte er beim Holland Festival mit. 1966 sang er am Teatro Fenice Venedig den Mandryka. 1969 war er in Amsterdam als Rigoletto zu Gast, 1964 und 1965 am Théâtre de la Monnaie in Brüssel als Rigoletto und 1981 als Siegmund in der »Walküre«, 1966 am Teatro Verdi in Triest als Wolfram. 1968 gastierte er an der Deutschen Oper Berlin, seit 1967 oft an der Staatsoper Hamburg, 1970 am Staatstheater von Karlsruhe, an der Sadler’s Wells Opera 1969 als Alvaro in »La forza del destino« und an der Scottish Opera Glasgow 1975-76 als Bacchus in »Ariadne auf Naxos« von R. Strauss. Dabei galten als seine weiteren großen Rollen im Bariton-Fach der Nabucco wie der Posa im »Don Carlos« von Verdi, der Graf Luna im »Troubadour«, der Ford im »Falstaff« von Verdi, der Jago im »Otello« vom gleichen Meister, der Alfio in »Cavalleria rusticana«, der Eugen Onegin von Tschaikowsky und der Don Giovanni. Seine Stimme wandelte sich dann jedoch zum Heldentenor. Als Tenor sang er u.a. den Peter Grimes in der gleichnamigen Oper von Benjamin Britten, den Herodes in »Salome« von R. Strauss und den Canio im »Bajazzo«. Er blieb bis 1970 an der Deutschen Oper am Rhein engagiert und sang dann 1971-76 und nochmals 1978-84 am Opernhaus von Köln. Bei den Bayreuther Festspielen 1972-73 übernahm er den Tannhäuser, 1981 in Köln den Florestan und den Erik in »Der fliegende Holländer«. Er starb am 23.11.2020 in Wien.
Schallplatten: Eurodisc (Querschnitte durch »Rigoletto« und »Faust« von Gounod, als Bariton), Mondo Musica (Mandryka in »Arabella« von R. Strauss, Teatro Fenice Venedig 1966).
17.12. Ludwig van BEETHOVEN: 250. Geburtstag
Ludwig van Beethovens väterliche Vorfahren stammten aus Mechelen, dem Sitz des Erzbischofs der Österreichischen Niederlande. Mit seinem Großvater Ludwig van Beethoven (1712–73) brachte die Familie erstmals einen Musiker hervor. Er wurde 1733 als Basssänger an den kurkölnischen Hof nach Bonn berufen, 1761 ernannte ihn Kurfürst und Erzbischof Maximilian Friedrich zum Hofkapellmeister. Ludwigs Sohn Johann (* 14. November 1740; † 18. Dezember 1792) wurde Tenorsänger an der Hofkapelle und erwarb sich darüber hinaus Ansehen als Musiklehrer. Am 12. November 1767 heiratete er die früh verwitwete Maria Magdalena Leym geb. Keverich (* 19. Dezember 1746). Aus der Ehe gingen sieben Kinder hervor, von denen nur drei das Säuglingsalter überlebten: Ludwig, Kaspar Karl (getauft 8. April 1774) und Nikolaus Johann (getauft 2. Oktober 1776). Die Geburt eines Bruders gleichen Namens Anfang April 1769 trug später zu Ludwig van Beethovens Verunsicherung über sein tatsächliches Alter bei. Als zweites Kind wurde Ludwig van Beethoven am 17. Dezember 1770 in der damaligen St.-Remigius-Kirche getauft; die Kirche brannte 1800 ab und ist nicht mit der heutigen St.-Remigius-Kirche an anderer Stelle zu verwechseln. Geboren wurde er wahrscheinlich am 16. Dezember in der Wohnung der Familie im Haus Nr. 515 (heute Haus Nr. 20) in der Bonngasse. Obwohl Beethoven erst drei Jahre alt war, als sein Großvater am 24. Dezember 1773 starb, verklärte er ihn zur Identifikationsfigur der Familie. Johann van Beethoven erkannte früh die außerordentliche Begabung seines Sohnes und sorgte für eine solide Musikausbildung, an der auch Kollegen der Hofkapelle mitwirkten: der Hoforganist Gilles van den Eeden, der Sänger Tobias Pfeifer, die Violinisten Franz Georg Rovantini, Franz Ries und andere. Über Johann van Beethovens Unterricht sind gewalttätige Übergriffe auf seinen Sohn überliefert. Ob diese Berichte regelmäßige oder vereinzelte Vorfälle schildern, ist unklar. Im Alter von sieben Jahren trat Beethoven zum ersten Mal öffentlich als Pianist auf. 1782 trat der Komponist und Kapellmeister Christian Gottlob Neefe die Nachfolge van den Eedens als Hoforganist an. Neefe erteilte Beethoven zeitweise Klavier- und Kompositionsunterricht und vermittelte die Veröffentlichung erster Klavierkompositionen: der Variationen über einen Marsch von Dressler WoO 63 und der sogenannten Kurfürstensonaten WoO 47. Ob ihm allerdings die herausragende Rolle als Lehrer Beethovens zukommt, die ihm in der Literatur zugeschrieben wurde, ist zweifelhaft. 1782 wurde Beethoven Stellvertreter Neefes an der Orgel, zwei Jahre später erhielt er eine feste Anstellung als Organist. Darüber hinaus wirkte er als Cembalist und Bratschist in der Hofkapelle. Ein Freund und Komponist, der ebenfalls dort musizierte, war Anton Reicha. Im Zusammenhang mit einer Neuorganisation der Hofmusik durch Maximilian Franz, den Nachfolger des verstorbenen Kurfürsten Max Friedrich, kam es 1784 zum Bruch zwischen Beethoven und Neefe. Beethovens Schulbildung ging über Grundlegendes wie Lesen, Schreiben und Rechnen kaum hinaus. Zusätzlich erhielt er aber zeitweise Privatunterricht in Latein, Französisch und Italienisch. Geistige Anregung erhielt er darüber hinaus von Freunden aus Bonner Bürgerkreisen, besonders von dem Medizinstudenten und späteren Arzt Franz Gerhard Wedeler sowie von der Familie von Breuning, zu der Beethoven eine geradezu familiäre Beziehung pflegte. Die Freundschaft zu Wegeler und zu Stephan von Breuning dauerte trotz gelegentlicher Krisen lebenslang. Am Hof des Kurfürsten Maximilian Franz herrschte ein liberales Klima. Aufklärerisches Gedankengut wurde u. a. in den Kreisen des Illuminatenordens, einer der radikalen Aufklärung verpflichteten Geheimgesellschaft, gepflegt. Zahlreiche Hofmusiker waren Mitglied der Bonner Loge, Neefe stand ihr vor. Nach dem Verbot der Illuminaten 1785 sammelten sich ihre Bonner Mitglieder in der 1787 gegründeten Lese- und Erholungsgesellschaft. Durch den an der Bonner Universität lehrenden Eulogius Schneider kam Beethoven auch früh mit den Ideen der Französischen Revolution in Berührung. 1784 schrieb Neefe über Beethoven, er werde „gewiß ein zweyter Wolfgang Amadeus Mozart werden, wenn er so fortschritte, wie er angefangen“. Bei Maximilian Franz, Kurfürst seit 1784 und erklärter Liebhaber der Musik Mozarts, traf diese Einschätzung auf fruchtbaren Boden. Ende Dezember 1786 brach Beethoven zu einer von Max Franz geförderten Reise nach Wien auf, um Kompositionsschüler Mozarts zu werden. Als Beethoven nach etwa dreimonatigem Aufenthalt die Rückreise antrat, unterbrach er diese mehrfach, um in Regensburg, München und Augsburg Station zu machen. Im Mai 1787 kehrte er nach Bonn zurück. Es ist nicht bekannt, ob es überhaupt zu einer Begegnung mit Mozart kam; für einen Unterricht durch das Vorbild fehlt jeder Beleg, und der Kurfürst zeigte sich von den Ergebnissen der Reise entsprechend enttäuscht. Der Grund für das Scheitern des Plans ist unklar. Zurück in Bonn traf Beethoven auf eine dramatisch veränderte familiäre Situation. Der Gesundheitszustand der an der „Schwindsucht“ erkrankten Mutter hatte sich in kritischer Weise verschlechtert. Sie verstarb am 17. Juli 1787. Der Vater verlor zunehmend die Kontrolle über seinen ohnehin hohen Alkoholkonsum, sodass er schließlich nicht mehr in der Lage war, für seine drei Söhne zu sorgen. 1789 wurde er vom Dienst suspendiert, und Ludwig als ältestem Sohn wurde die Verfügungsgewalt über die Hälfte der Pension des Vaters erteilt, wodurch ihm faktisch die Rolle des Familienoberhauptes zufiel. Mitte September 1791 kam Beethoven als Organist und Bratschist der Bonner Hofkapelle zu einem Generalkapitel des Deutschen Ordens nach Mergentheim und Aschaffenburg. Die Reise der kurkölnischen Hofkapelle ging auf zwei Schiffen vonstatten, die über Rhein und Main bis Miltenberg fuhren. Beethoven, von seinen Freunden seines bräunlichen Teints und der schwarzen Augen wegen Spagnol genannt, agierte hierbei als Küchenjunge. Von Miltenberg ging es mit der Kutsche weiter nach Mergentheim, wo sich Beethoven bis Ende Oktober 1791 aufhielt. Durch seinen Eintritt in den Deutschen Orden kam der aus Wien stammende Graf Ferdinand Ernst von Waldstein nach Bonn. Er wurde Beethovens erster adeliger Förderer, regte ihn zu Kompositionen an, so zur Musik zu einem Ritterballett WoO 1 und zu den Variationen über ein Thema von Graf Waldstein WoO 67, und nutzte seinen Einfluss auf den Kurfürsten, um ihn zur Fortsetzung der Förderung Beethovens zu bewegen. Als im Juli 1792 Joseph Haydn auf dem Rückweg einer Englandreise in Bonn Station machte, wurde ein zweiter Studienaufenthalt Beethovens in Wien vereinbart. Nachdem Mozart bereits verstorben war, sollte er nun – nach einem Stammbucheintrag Waldsteins – „Mozart’s Geist aus Haydens Händen“ erhalten. Noch im November desselben Jahres brach Beethoven nach Wien auf. Das Hammerklavier im Beethovenhaus Baden, auf dem Ludwig van Beethoven gespielt hat, wurde restauriert und rechtzeitig zu seinem 250. Geburtstag 2020 wieder spielbar gemacht; es ist im Kaiserhaus im Rahmen der Ausstellung „Mythos Ludwig Van“ bis 20. Dezember 2020 zu sehen. Eine Folge von Ereignissen bewirkte, dass aus Beethovens Studienreise nach Wien ein dauerhafter und endgültiger Aufenthalt wurde. Kurz nach Beethovens Ankunft, am 18. Dezember 1792, starb sein Vater. 1794 besetzten französische Truppen das Rheinland, und der kurfürstliche Hof musste fliehen. Damit war Beethoven nicht nur der Boden für die Rückkehr nach Bonn entzogen, auch die Gehaltszahlungen des Kurfürsten blieben nun aus. Im Frühjahr 1794 schließlich übersiedelte sein Bruder Kaspar Karl nach Wien, im Dezember 1795 folgte auch Bruder Johann. In Wien fand Beethoven bald die Unterstützung adeliger Musikliebhaber, die ihm halfen, in der neuen Heimat Fuß zu fassen, darunter Fürst Franz Joseph Maximilian von Lobkowitz und Gottfried Freiherr van Swieten. Eine besondere Rolle spielte Fürst Karl Lichnowsky; in seinem Haus knüpfte Beethoven Kontakte zu Wiener Musikerkreisen und lernte den Geiger Ihnaz Schuppanzigh kennen, der als Interpret wesentlich zur Verbreitung seiner Werke beitragen sollte. Lichnowsky stellte Beethoven zeitweise eine Wohnung in seinem Haus zur Verfügung. Ab 1800 zahlte Lichnowsky an Beethoven ein jährliches Gehalt in Höhe von 600 Gulden und schuf damit für die folgenden Jahre die Grundlage für eine unabhängige künstlerische Existenz. Seit 1802 genoss er auch die Rechte eines Staatsbürgers. Wie vereinbart nahm Beethoven bei Haydn Kompositionsunterricht, der von Beethovens Ankunft in Wien (November 1792) bis kurz vor Haydns Abreise nach England (19. Januar 1794) gedauert hat. Das Verhältnis zwischen dem renommierten Lehrer und dem eigenwilligen, selbstbewussten Schüler blieb nicht frei von Meinungsverschiedenheiten und Konflikten; so als Haydn Bedenken gegen Beethovens Klaviertrio op. 1 Nr. 3 äußerte, da er es für zu schwer verständlich hielt. Auch wenn Beethoven einmal über seinen Lehrer gesagt haben soll, „nie etwas von ihm gelernt“ zu haben, so prägten Haydns Werke doch Beethovens Entwicklung als Komponist nachhaltig, vor allem auf den Gebieten der Sinfonie und der Kammermusik. Allerdings scheint Beethoven mit Haydn als Lehrer unzufrieden gewesen zu sein. Heimlich nahm er Unterricht bei Johann Baptist Schenk. Ab 1794 studierte er Kontrapunkt bei Johann Georg Albrechtsberger, und von Antonio Salieri ließ er sich in der Gesangskomposition unterweisen. Beethovens Erfolge als Komponist hängen anfangs eng mit seiner Karriere als Klaviervirtuose zusammen. In den ersten zehn Jahren in Wien entstanden allein 20 seiner 32 Klaviersonaten, darunter die Grande Sonate pathétique op. 13 in c-Moll und die beiden Sonaten op. 27, deren zweite unter der (nicht von Beethoven stammenden) Bezeichnung „Mondscheinsonate“ bekannt wurde; der Titelzusatz „quasi una fantasia“ deutet an, dass die Improvisation am Klavier eine wichtige Inspirationsquelle für den Komponisten war. Am 29. März 1795 trat Beethoven mit seinem Klavierkonzert B-Dur op. 19 erstmals als Pianist an die Wiener Öffentlichkeit. Besonderes Aufsehen erregte er auch durch seine herausragende Fähigkeit zum freien Fantasieren. 1796 unternahm der junge Virtuose eine Konzertreise nach Prag, Dresden, Leipzig und Berlin, die ein großer künstlerischer und finanzieller Erfolg wurde. Die von Lichnowsky initiierte Tournee folgte der Route der Reise, die der Fürst 1789 mit Mozart unternommen hatte. Die ersten Kompositionen, die Beethoven drucken ließ, waren die drei 1794/95 entstandenen Klaviertrios, die er mit der Opusnummer 1 versah. In den folgenden Jahren setzte sich Beethoven mit zwei weiteren zentralen Gattungen der Klassik auseinander: dem Streichquartett und der Sinfonie. Zwischen 1798 und 1800 komponierte er, nach intensivem Studium der Quartette Haydns und Mozarts, eine erste Serie von sechs Quartetten, die er als op. 18 dem Fürsten Lobkowitz widmete. Kurz darauf, 1800 und 1802, präsentierte sich Beethoven als Sinfoniker. Die Widmung der 1. Sinfonie op. 21 in C-Dur ging an van Swieten, die der 2. Sinfonie op. 36 in D-Dur an den Fürsten Lichnowsky. Beethovens wachsender Erfolg als Pianist und Komponist wurde von einer schwerwiegenden Beeinträchtigung überschattet: Etwa um 1798 zeigten sich erste Symptome jenes Gehörleidens, das schließlich zur fast völligen Taubheit führen sollte. Nach Beethovens eigenem Bericht aus dem Jahr 1801 verschlimmerte sich das Leiden innerhalb weniger Jahre; es scheint jedoch in den Folgejahren einige Zeit stagniert zu haben. Die Ursache der Erkrankung ist Gegenstand zahlreicher Untersuchungen. Zu den möglichen Ursachen zählen eine Atrophie der Gehörnerven oder eine Otosklerose. Beethovens Gehörleiden stellte nicht nur eine ernste Bedrohung seiner Laufbahn als Musiker dar; es beeinträchtigte auch seinen gesellschaftlichen Umgang. Die Krankheit stürzte Beethoven in eine schwere persönliche Krise, die ihn zeitweilig sogar an Suizid denken ließ. Beethoven offenbarte seinen Seelenzustand im sogenannten Heiligenstädter Testament, einem Schriftstück, das er im Oktober 1802 am Ende einer Kur in Heiligenstadt verfasste, nachdem auch diese ohne den erhofften Erfolg geblieben war. Die mittleren Wiener Jahre, vom Beethoven-Biographen Maynard Solomon als die „heroische Periode“ bezeichnet, sind, der Beeinträchtigung durch das Gehörleiden zum Trotz, die produktivste Phase in Beethovens Schaffensbiographie. Beethoven hatte zu dieser Zeit einen eigenen unverwechselbaren Stil entwickelt. Sechs der neun Sinfonien komponierte Beethoven allein zwischen Herbst 1802 und 1812, darunter so bekannte Werke wie die 3. Sinfonie Eroica, die 5. Sinfonie und die 6. Sinfonie Pastorale. Darüber hinaus entstanden das 4. und 5. Klavierkonzert sowie die Endfassung des 3. Klavierkonzerts, das Violinkonzert op. 61 und die fünf „mittleren“ Streichquartette op. 59 Nr. 1-3, op. 74 und op. 95. Auch die erste Fassung seiner einzigen Oper Fidelio komponierte Beethoven in dieser Zeit. Am 20. November 1805 wurde sie unter dem ursprünglichen Titel Leonore zum ersten Mal aufgeführt, in der Folge aber noch zweimal überarbeitet. Seinen bis dahin größten Erfolg erzielte Beethoven 1813/14 mit den Aufführungen eines eigens aus Anlass des Wiener Kongresses komponierten Werkes, Wellingtons Sieg oder Die Schlacht bei Vittoria op. 91, das den entscheidenden Sieg der Engländer über die napoleonischen Truppen schildert und damit beim Publikum den Geist der Zeit traf. Die Französische Revolution und Napoleon Bonaparte hatten auf Beethoven einen starken Eindruck gemacht und wirkten sich nachweislich auf sein Schaffen aus. So hatte Beethoven die 3. Sinfonie Eroica ursprünglich mit dem Zusatz „intitulata Bonaparte“ oder „geschrieben auf Bonaparte“ versehen wollen. Eine Anekdote berichtet, Beethoven habe den Titelzusatz wütend entfernt, nachdem Napoléon im Dezember 1804 sich selbst zum Kaiser gekrönt hatte. Wahrscheinlich hängt die Änderung des ursprünglichen Titels eher mit einer geplanten, aber letztlich nicht durchgeführten Reise nach Paris zusammen. Auf eine französische Revolutionsoper, Léonore ou L’amour conjugal (Leonore oder Die eheliche Liebe) von Jean Nicolas Bouilly, geht der Stoff zurück, den Beethoven in seiner Oper Fidelio verarbeitete, und in seiner 5. Sinfonie in c-Moll op. 67 griff er Elemente der sogenannten Revolutionsmusik auf, eines Stils, den französische Komponisten wie André-Ernest-Mopdeste Grétry, Etienne-Nicolas Méhul und Luigi Cherubini Ende des 18. Jahrhunderts geprägt hatten. Im Verhältnis zwischen Beethoven und seinem bis dahin wichtigsten Mäzen, dem Fürsten Lichnowsky, kam es im Laufe der Jahre zu einer zunehmenden Entfremdung. Die Spannungen eskalierten im Herbst 1806 bei einem Aufenthalt Beethovens auf Schloss Grätz (tschechisch Hradec) bei Troppau (tschechisch Opava), dem Sitz des Fürsten, in einer ernsten Auseinandersetzung. Etwa zur gleichen Zeit, 1806 oder 1807, stellte Lichnowsky, der in jenen Jahren außerordentlich hohe finanzielle Verpflichtungen zu erfüllen hatte, die jährlichen Gehaltszahlungen an den Komponisten ein. Zwar bezog Beethoven neben dem fürstlichen Gehalt nicht unerhebliche Einkünfte aus Verlagsverträgen und Konzerteinnahmen, doch garantierten diese keine dauerhafte finanzielle Absicherung. Daher bewarb sich Beethoven im Dezember 1807 – vergeblich – bei der k.k. Hoftheaterdirektion um eine Anstellung und erwog darüber hinaus, Wien zu verlassen. Eine entsprechende Gelegenheit bot sich, als ihn Friedrich Luwig III. Graf Truchsess zu Waldburg im November 1808 als Kapellmeister an den Hof Jérôme Bonapartes nach Kassel berief. Durch eine Initiative Ignaz von Gleichensteins und der Gräfin Marie Erdödy, die zu Beethovens engstem Freundeskreis gehörten, gelang es, Beethoven in Wien zu halten. Am 1. März 1809 sicherten Erzherzog Rudolph, Franz Joseph Fürst Lobkowitz und Ferdinand Fürst Kinsky dem Komponisten per Dekret ein festes jährliches Gehalt zu unter der einzigen Bedingung, dass Beethoven in Wien wohnen bliebe (der sogenannte Rentenvertrag). Die Hoffnung Beethovens auf finanzielle Unabhängigkeit erhielt jedoch nach kurzer Zeit gleich mehrere Rückschläge: die Geldentwertung durch das sogenannte Finanzpatent im Frühjahr 1811, der Tod des Fürsten Kinsky im folgenden Jahr und der drohende Bankrott des Fürsten Lobkowitz 1813. Dadurch war Beethoven gezwungen, die Fortsetzung der Zahlungen gerichtlich einzuklagen. Beethovens Wertschätzung Johann Wolfgang von Goethes begann sich seit den 1790er Jahren vor allem in seinen Liedkompositionen niederzuschlagen. 1809/10 kumulierte die kompositorische Beschäftigung mit dem Dichter in den Liederzyklen op. 75 und op. 83 sowie der Schauspielmusik zu Egmont op. 84. Während ihres Wienaufenthalts im Frühjahr-Sommer 1810 lernte Beethoven Ende Mai Bettina Brentano kennen, die Schwester des Dichters Clemens Brentano. Sie gewann sein Vertrauen und nutzte ihre Freundschaft zu Goethe, ein Treffen der beiden Künstlerpersönlichkeiten anzuregen. Durch die literarisch stark überformten Darstellungen ihrer Beziehung zu Beethoven hat Bettina Brentano später das romantische Beethoven-Bild maßgeblich mit geprägt. Zur lange angebahnten Zusammenkunft zwischen Beethoven und Goethe kam es im Juli 1812 (19., 20., 21. und 23.), als sich beide im böhmischen Kurbad Teplitz aufhielten. Das Ergebnis war eher durchwachsen: Am 19. Juli schrieb Goethe an seine Frau: „Zusammengefaßter, energischer, inniger habe ich noch keinen Künstler gesehen. Ich begreife recht gut, wie er gegen die Welt wunderlich stehen muß.“ Und am 12. September 1812 schrieb Goethe aus Karlsbad an seinen Freund Carl Friedrich Zelter, den Leiter der Berliner Sing-Akademie: „Beethoven habe ich in Teplitz kennengelernt. Sein Talent hat mich in Erstaunen gesetzt; allein er ist leider eine ganz ungebändigte Persönlichkeit, die zwar gar nicht unrecht hat, wenn sie die Welt detestabel findet, aber sie freilich dadurch weder für sich noch für andre genußreicher macht. Sehr zu entschuldigen ist er hingegen und sehr zu bedauern, da ihn sein Gehör verläßt, was vielleicht dem musikalischen Teil seines Wesens weniger als dem geselligen schadet. Er, der ohnehin lakonischer Natur ist, wird es nun doppelt durch diesen Mangel.“ Dagegen schrieb Beethoven lakonisch am 9. August von Franzensbad an seinen Verleger Härtel: „Göthe behagt die Hofluft sehr, mehr als einem Dichter ziemt. Es ist nicht vielmehr über die Lächerlichkeiten der Virtuosen hier zu reden, wenn Dichter, die als die ersten Lehrer der Nation angesehen sein sollten, über diesem Schimmer alles andere vergessen können.“ Zwar war Beethoven nach einer Aussage von Franz Gerhard Wegeler „sehr häufig verliebt“, doch bezog sich dies nur auf eine kurze Periode in den 1790er Jahren, als Wegeler in Wien war. Frauen spielten jedoch in vieler Hinsicht eine große Rolle in Beethovens Leben: als Freundinnen und Vertraute, als Interpretinnen oder als Widmungsempfängerinnen. Beethovens erste große Liebe galt Johanna von Honrath. Sein Jugendfreund Franz Gerhard Wegeler schreibt über die Bonner Jugendzeit des Komponisten: „Seine und Stephan von Breuning’s erste Liebe war Fräulein Jeanette d’Honrath aus Köln, Neumarkt Nro. 19. (jetziges Wohnhaus des Baumeisters Herrn Biercher), die oft einige Wochen in der von Breuning’schen Familie in Bonn zubrachte. Sie war eine schöne, lebhafte Blondine, von gefälliger Bildung und freundlicher Gesinnung, welche viele Freude an der Musik und eine angenehme Stimme hatte.“ Maria Anna Wilhelmine von und zu Westerholt-Gysenberg war wohl ebenfalls eine Jugendliebe Beethovens. Er selbst spricht sie in seinem Brief als „ma très chere amie“ (deutsch „meine sehr liebe Freundin“) an, was eher für eine innige Freundschaft als für Liebe spricht. Sein Jugendfreund Franz Gerhard Wegeler schreibt dagegen einige Jahre später über Beethovens erste Liebe von einem Fräulein v. W. – wobei er unbekannt lässt, welche Person er damit meinte: „Darauf folgte die liebevollste Zuneigung zu einer schönen und artigen Fräulein v. W., von welcher Werther-Liebe Bernhard Romberg mir vor drei Jahren noch Anecdoten erzählte. Diese Liebschaften fielen jedoch in das Uebergangs-Alter und hinterließen eben so wenig tiefe Eindrücke, als sie deren bei den Schönen erweckt hatten.“ Zu Beethovens längsten und treuesten Freundinnen gehörte die Gräfin Marie von Erdödy (1779–1837). Mehrere seiner Werke sind ihr gewidmet. Sie besaß außer ihrer Stadtwohnung ein Haus in Jedlesee, in dem Beethoven 1815 gewohnt haben soll. In der älteren Literatur wird verschiedentlich vermutet, dass es eine kurzzeitige Liebesbeziehung zwischen Beethoven und der Gräfin gab, was jedoch reine Spekulation ist. Besonders freundschaftlich wurde Beethoven von der ungarischen Familie Brunsvik aufgenommen. Die Schwestern Therese, Josephine, Charlotte und ihr Bruder Franz begegneten dem Komponisten erstmals 1799. Als die Familie nach 18 Tagen wieder in ihre ungarische Heimat zurückkehrte, schrieb Beethoven in Josephines und Thereses Album einen Auszug von Goethes Gedicht „Ich denke dein“. Auf Drängen der Mutter, die ihre schöne Tochter mit einem wohlhabenden Adligen vermählen wollte, heiratete Josephine Brunsvik noch im Sommer 1799 den Grafen Joseph von Deym, zog zu ihm nach Wien und gebar in ihrer kurzen Ehe vier Kinder. In dieser Zeit war Beethoven Josephines Klavierlehrer und regelmäßiger „standhafter Besucher der jungen Gräfin“. Nachdem Graf Deym Anfang 1804 unerwartet gestorben war, entwickelte sich zwischen Beethoven und Josephine eine Liebesbeziehung. Zwischen 1804 und 1809 schrieb Beethoven Josephine mindestens vierzehn teils leidenschaftliche Liebesbriefe, in denen er sie unter anderem als „Engel“, „mein Alles“ und als seine „einzig Geliebte“ bezeichnete und ihr „ewige Treue“ schwor. Der Briefwechsel, soweit erhalten, dokumentiert aber auch die seelischen Konflikte des Paares, die aus dem Widerspruch zwischen ihren persönlichen Gefühlen und den Zwängen der Realität resultierten: Josephine hatte vier Kinder zu versorgen, und im Falle einer Heirat mit dem nichtadligen Beethoven hätte sie die Vormundschaft für sie verloren. Im Herbst 1807 zog sich Josephine schließlich auf Druck ihrer Familie von Beethoven zurück. Bereits 1805 hatte Therese voller Besorgnis an Charlotte geschrieben: „Aber sage mir, Pepi und Beethoven, was soll daraus werden? Sie soll auf ihrer Hut sein! … Ihr Herz muß die Kraft haben nein zu sagen, eine traurige Pflicht, wenn nicht die traurigste aller.“ 1810 ging Josephine eine zweite Ehe mit dem estnischen Baron Christoph von Stackelberg ein, die sich für sie äußerst unglücklich entwickelte. Ende Juni/Anfang Juli 1812 verließ Stackelberg sie. In ihrem Tagebucheintrag vom 8. Juni 1812 heißt es: „Ich habe heute einen schweren Tag. – Die Hand des Schicksals ruht düster auf mir – Ich sah nebst meinem tiefen Kummer auch noch die Entartung meiner Kinder und – fast – aller Muth wich von mir –!!!“Kurz darauf notierte sie in ihrem Tagebuch, dass sie beabsichtigte, nach Prag zu reisen: „St. will daß ich mir selbst sitzen soll [er hat mich sitzen gelassen]. er ist gefühllos für bittende in der Noth. […] Ich will Liebert in Prague [!] sprechen. ich will die Kinder nie von mir lassen. […] Ich habe Stackb zu liebe [mich] physisch zugrunde gerichtet indem ich […] noch so viele Kummer und Krankheit durch ihn zugezogen habe.“ In Prag traf Beethoven am 3. Juli seine „Unsterbliche Geliebte“. 1817 notierte Therese, die weiterhin mit Beethoven in Verbindung blieb, in ihrem Tagebuch über ihre kranke Schwester: „Ob Josephine nicht Strafe leidet wegen Luigi’s Weh? Seine Gattin – was hätte sie nicht aus dem Heros gemacht!“ Eine Tagebuchnotiz Thereses von 1848 lautet: „Ich Glückliche hatte Beethovens intimen, geistigen Umgang so viele Jahre! Josephinens Haus- und Herzensfreund! Sie waren füreinander geboren und lebten beide noch, hätten sie sich vereint.“ Zahlreiche Beethoven-Forschende, vor allem im deutschsprachigen Raum, darunter La Mara, Siegmund Kaznelson, Harry Goldschmidt, Brigitte und Jean Massin, Marie-Elisabeth Tellenbach, Carl Dahlhaus und Rita Steblin, halten Josephine für Beethovens „Unsterbliche Geliebte“. Neun Monate nach dem wahrscheinlichen Treffen der beiden in Prag brachte Josephine ihre Tochter Minona (* 8. April 1813 in Wien; † 21. Februar 1897 ebenda) – Minona ist ein Anagramm zu Anonym – zur Welt. Daher erachten etliche Forscher für wahrscheinlich, dass Beethoven der leibliche Vater Minonas ist. Der estnische Komponist Jüri Reinvere verarbeitete den Stoff um Beethovens mutmaßliche Tochter in seiner Oper Minona, welche am 25. Januar 2020 am Theater Regensburg Premiere feierte. Über die Schwestern Brunsvik lernte Beethoven um 1801/02 auch deren Cousine Gräfin Giulietta Guicciardi (1782–1856) kennen und verliebte sich kurzzeitig in sie. Er war sich jedoch darüber im Klaren, dass eine Heirat wegen des Standesunterschiedes nicht in Frage kam. Außerdem war sie bereits mit dem Grafen Wenzel von Gallenberg verlobt, den sie 1803 heiratete. Beethoven widmete ihr 1802 die als „Mondscheinsonate“ bekannte Sonata quasi una Fantasia, op. 27 Nr. 2. Eine weitere mutmaßliche Geliebte Beethovens war Therese von Zandt, die zur Zeit ihrer siebenmonatigen Liaison mit dem Komponisten Stiftsdame im freiweltlichen Damenstift Asbeck war. Therese von Zandt veröffentlichte ab 1798 unter dem Kürzel Z. als erste Frau Beiträge in der Leipziger Allgemeinen musikalischen Zeitung. Möglicherweise war sie es, die Beethoven den Stoff zu seiner einzigen Oper Fidelio empfahl, als sie im Auftrag der Zeitung vom 5. Dezember 1803 bis zum 5. Juli 1804 nach Wien reiste. Jean-Nicolas Bouilly Libretto zur Oper Léonore ou L’amour conjugaldes Fidelio, auf dem der Fidelio-Stoff basiert, wurde damals von Friedrich Rochlitz, Begründer und Redakteur der Allgemeinen musikalischen Zeitung, erstmals aus dem Französischen ins Deutsche übersetzt. Ein Porträt aus Beethovens Besitz, von dem man 200 Jahre lang annahm, es zeige Giulietta Guicciardi, ist nach Forschungen von Klaus Martin Kopitz vermutlich Therese von Zandt zuzuschreiben. Mit der französischen Pianistin Marie Bigot verkehrte Beethoven insbesondere im Jahre 1807. Die Freundschaft kam wahrscheinlich zustande, da Maries Gatte Paul Bigot bei Beethovens Gönner, dem Grafen Andrej Rasumowsky, als Bibliothekar tätig war. Von der Beziehung zeugen mehrere Briefe Beethovens. Er schenkte Marie auch das Autograph seiner berühmten Appassionata, das sich heute in der Bibliothèque nationale de France in Paris befindet. Anfang März 1807 lud Beethoven Marie zu einer Spazierfahrt ein, als ihr Mann abwesend war. Dessen offensichtlich eifersüchtige Reaktion veranlasste Beethoven, kurz darauf einen Entschuldigungsbrief an das Ehepaar zu schreiben, in dem er betonte: „[…] ohnedem ist es einer meiner ersten Grundsätze nie in einem andern als Freundschaftlichen Verhältniß mit der Gattin eines andern zu stehen.“ Etwa im Frühjahr 1808 begegnete Beethoven erstmals der damals 15-jährigen Sängerin Elisabeth Röckel, der Schwester des Tenors Joseph August Röckel, der in den Fidelio-Aufführungen von 1806 die Partie des Florestan übernommen hatte. Zusammen mit ihrem Bruder wohnte sie in einer Dienstwohnung des Theaters an der Wien, wo sie als „Elis. [!] Rökel“ verzeichnet wurde und sich mit der gleichfalls dort lebenden Sängerin Anna Milder-Hauptmann befreundete, von der sie in einem Brief tatsächlich mit „Elise“ [!] angeredet wurde. Nach einer zweifelhaften Aussage von Anton Schindler gegenüber Gerhard von Breuning wollte Beethoven sie heiraten. Sie selbst hat das später bestritten, berichtete aber mehrfach, dass Beethoven ihr sehr zugetan war. In ihrem offiziellen Nekrolog heißt es: „Zu ihren Verehrern gehörte auch Beethoven.“ 2010 stellte Klaus Martin Kopitz die These auf, Beethoven habe für sie am 27. April 1810 sein berühmtes Albumblatt „Für Elise“ komponiert. 2015 veröffentlichte er weitere, bislang unbekannte Quellen über ihre Beziehung zu Beethoven. Das Autograph des Albumblattes war später im Besitz von Therese Malfatti, aus deren Nachlass es nach München zu der Lehrerin Babette Bredl gelangte, der Mutter von Malfattis Hausfreund und Erbe Rudolph Schachner. Bredl lieh das Autograph Ludwig Nohl, der es abschrieb und publizierte. Obwohl er ausdrücklich erklärte, es sei „nicht für Therese geschrieben“, sind mehrere Beethoven-Forscher der Ansicht, sie sei dennoch als Widmungsempfängerin anzusehen. Elisabeth Röckel heiratete 1813 Johann Nepomuk Hummel und zog mit ihm nach Weimar, kam aber im März 1827 noch einmal nach Wien. Auf Wunsch des sterbenden Beethoven besuchte sie diesen mehrfach und erhielt zum Andenken eine Locke des Komponisten und dessen letzte Schreibfeder. Die Reliquien sind seit 2012 im Besitz des Beethoven Center der San José State University. Kurz nach dem Tode des Komponisten gestand sie Schindler, „welch’ tiefe Wurzeln ihre einstige Liebe zu Beeth. geschlagen u noch immer in ihr lebe.“ Der Musikwissenschaftler Michael Lorenz bezweifelte 2011, dass Elisabeth sich „Elise“ nannte, da dies nur durch wenige Quellen zu belegen ist. Wie er aber gleichfalls bemerkt, „wurde im Wien des Vormärz zwischen den Namen Elisabeth und Elise nicht mehr unterschieden, sie waren austauschbar und quasi identisch“. Eine weitere Frau in Beethovens Leben war Therese Malfatti. Beethoven lernte sie 1809 durch seinen Freund Ignaz von Gleichenstein kennen, der 1811 Thereses Schwester Anna heiratete. Im Frühjahr 1810, angesichts Josephine Brunsviks Wiederverheiratung, plante Beethoven offenbar, Therese Malfatti einen Heiratsantrag zu machen, und ließ sich dafür von seinem Freund Franz Gerhard Wegeler in Bonn eine Abschrift seines Taufscheins besorgen. Als dann Therese von Malfatti seinen Antrag aber abwies – ihre Familie war aus Standesrücksichten ebenfalls dagegen –, überwand Beethoven diese Ablehnung vergleichsweise leicht. Therese blieb danach freundschaftlich mit ihm verbunden. Ende Mai 1810 lernte Beethoven durch Bettina Brentano deren Schwägerin Antonie Brentano kennen, die von 1809 bis 1812 in Wien lebte, um den umfangreichen Nachlass ihres verstorbenen Vaters Johann Melchior Edler von Birkenstock zu verkaufen. Sie schrieb im März 1811 in einem Brief an Bettina, Beethoven sei ihr „einer der liebsten Menschen“ geworden und besuche sie „beinahe täglich“. Zwischen dem Ehepaar Franz und Antonie Brentano und Beethoven entwickelte sich eine freundschaftliche Beziehung, die Antonie in ihrem Tagebuch als „Wahlverwandtschaft“ bezeichnete. Sie besaß auch das Autograph von Beethovens Lied An die Geliebte, WoO 140, auf dem von ihrer Hand vermerkt ist: „den 2n März 1812 mir vom Author erbethen“. Dieses Lied hatte Beethoven kurz zuvor der bayerischen Sängerin Regina Lang ins Stammbuch geschrieben. 1972 stellte Maynard Solomon die Hypothese auf, Beethovens Brief an die Unsterbliche Geliebte vom 6./7. Juli 1812 sei an Antonie Brentano gerichtet. Antonie reiste mit ihrer Familie von Prag nach Karlsbad weiter. Obwohl sich nicht beweisen lässt, dass Beethoven in Prag mit Antonie zusammentraf, und die „Unsterbliche Geliebte“ möglicherweise doch nicht nach „K“ ging, haben sich mittlerweile zahlreiche Beethoven-Forscher dieser Hypothese angeschlossen, darunter Yayoi Aoki, Barry Cooper, William Kinderman, Klaus Martin Kopitz, Lewis Lockwood und Susan Lund. Beethovens „Brief an die Unsterbliche Geliebte“, den er am 6./7. Juli 1812 in Teplitz während einer Reise in die böhmischen Kurbäder verfasste, ist neben dem Heilgenstädter Testament das bedeutendste Selbstzeugnis des Komponisten. Er richtet sich an eine namentlich nicht genannte Frau, mit der es kurz zuvor, am 3. Juli in Prag, zu einer für die Zukunft der Beziehung entscheidenden Begegnung gekommen war. Aus dem Brief geht unter anderem die gegenseitig eingestandene Liebe hervor und die Hoffnung auf eine dauerhafte Verbindung der Liebenden, der aber offenbar große Hindernisse entgegenstehen. Die Identität der „Unsterblichen Geliebten“ ist unter Beethoven-Forschern umstritten. Vom Jahr 1812 an begann sich Beethovens Lebenssituation deutlich zum Schlechteren zu verändern. Zu den schicksalhaften Ereignissen um die „Unsterbliche Geliebte“ kamen materielle Sorgen im Zusammenhang mit dem Rentenvertrag und eine Verschlimmerung des Gehörleidens bis hin zur völligen Taubheit. Von etwa 1813 an verwendete Beethoven Hörrohre, um mit seiner Umgebung zu kommunizieren, ab 1818 ist der Gebrauch sogenannter Konversationshefte nachzuweisen, worin die Gesprächspartner ihre Äußerungen notierten. Aufgrund seiner fortgeschrittenen Schwerhörigkeit war es ihm nicht mehr möglich, als Pianist aufzutreten. Am 15. November 1815 starb Beethovens Bruder Kaspar Karl und hinterließ einen neun Jahre alten Sohn. Beethoven verstrickte sich in einen über Jahre andauernden, zermürbenden Rechtsstreit mit seiner Schwägerin Johanna um die Vormundschaft über seinen Neffen Karl, in dessen Verlauf ihm diese wechselweise zu- und wieder abgesprochen wurde. In seiner Funktion als Ersatzvater scheiterte Beethoven mit dem Versuch, den Schützling seinen moralisch überzogenen Erziehungszielen zu unterwerfen. Gleichzeitig mit Beethovens persönlicher Krise vollzog sich ein Wandel seines kompositorischen Stils. 1813 bis 1814 war er zunächst mit der Komposition von Wellingtons Sieg sowie einer gründlichen Revision seiner Oper Leonore zu Fidelio beschäftigt. In den Folgejahren wandte sich Beethoven noch einmal intensiv der Klaviersonate zu. Es entstanden die Sonaten op. 90 (1814), op. 101 (1815–17) und op. 106 („Hammerklavier-Sonate“, 1817–18). Gleichzeitig schuf Beethoven die beiden Cellosonaten op. 102 (1815), den Liederkreis An die ferne Geliebte op. 98 (1816) sowie die Vertonung von Goethes Meeres Stille und glückliche Fahrt für Chor und Orchester op. 112. Hatte sich Beethoven einige Jahre fast ausschließlich Werken für kleinere Besetzungen gewidmet, so bot sich 1819 ein Anlass, wieder ein größeres Werk in Angriff zu nehmen. Sein langjähriger Mäzen und Klavierschüler, der Erzherzog Rudolph, sollte am 20. März 1820 als Erzbischof von Olmütz (tschechisch Olomouc) inthronisiert werden. Beethoven wurde mit der Komposition einer großen feierlichen Messe beauftragt. Doch der Kompositionsprozess der Missa solemnis op. 123 begann sich zu verselbständigen, sodass Beethoven das Werk erst Ende 1822 / Anfang 1823 vollendete. Gleichzeitig mit der Messe arbeitete Beethoven an den 33 Veränderungen über einen Walzer von Anton Diabelli op. 120, einem Variationenzyklus für Klavier, der auf einen Aufruf des Musikverlegers und Komponisten Diabelli zurückging. Dieser hatte seinen Walzer an zahlreiche Komponisten geschickt mit der Bitte, je eine Variation zu einer geplanten Sammelausgabe beizusteuern. Während der Arbeit an der Missa solemnis und den Diabelli-Variationen setzte Beethoven mit op. 109, 110 und 111 die Serie seiner letzten Klaviersonaten fort. Nach mehr als zehnjähriger Pause wandte sich Beethoven auch wieder der Gattung Sinfonie zu. Die Uraufführung der 9. Sinfonie op. 125 am 7. Mai 1824 wurde vom Publikum begeistert aufgenommen. Die Aufführung leitete der Kapellmeister Michael Umlauf, Beethoven stand mit ihm zur Unterstützung am Dirigentenpult. Schließlich entstand zwischen Frühjahr 1824 und Herbst 1826 beginnend mit dem Streichquartett op. 127 eine letzte Gruppe von fünf Streichquartetten. Angestoßen hatte die Quartettproduktion ein Kompositionsauftrag des russischen Musikliebhabers Nikolai Borisowitsch Fürst Galitzin. Zusätzliche Motivation erhielt Beethoven durch die Rückkehr des Geigers Ignaz Schuppanzigh nach Wien, der seit 1816 auf Reisen gewesen war und dessen Ensemble fast alle seine früheren Streichquartette uraufgeführt hatte. Das Streichquartett in F-Dur op. 135 war das letzte Werk, das Beethoven vollendete. Durch die Taubheit war Beethoven in den letzten Jahren zunehmend auf die Unterstützung durch Freunde und Bekannte angewiesen. Zwar hatte Beethoven Hauspersonal (Köchin und Haushälterin), doch führten heftige Auseinandersetzungen mit den Angestellten mehrfach zu Kündigungen von der einen oder anderen Seite. Schon früher hatte Beethoven Personen aus dem Freundeskreis zur Erledigung von Besorgungen und anderen Diensten genutzt, so etwa 1817/18 die Klavierbauerin Nannette Streicher geb. Stein. Die freundschaftliche Verbindung Beethovens zur Klavierbauerfamilie Stein geht schon auf seinen frühen Aufenthalt in Augsburg 1787 zurück. Nanette Streicher kümmerte sich um die Haushaltsführung und vermittelte oft auch zwischen dem Komponisten und seinem Hauspersonal. 1822 tauchte erstmals Anton Schindler in Beethovens Bekanntenkreis auf. Schindler suchte Beethovens Nähe und diente sich ihm als Faktotum an. Seine Mischung aus Servilität und Eigenmächtigkeit war immer wieder Auslöser für dessen Unmut und Verachtung. Nach Beethovens Tod brachte Schindler Dokumente aus dessen Nachlass, so einen Teil der Konversationshefte, in seinen Besitz. Schindler verfasste eine der frühesten Beethoven-Biographien, doch ist die Glaubwürdigkeit vieler seiner Angaben zweifelhaft, da er zur Untermauerung seiner Behauptungen auch vor Fälschungen nicht zurückschreckte. Im Sommer 1825, nach dem Bruch mit Schindler, übernahm Karl Holz, der zweite Geiger aus dem Schuppanzigh-Quartett, die Funktion des persönlichen Sekretärs und Beraters. Gerade in den letzten Monaten seines Lebens gewann die Freundschaft mit Beethovens Jugendfreund Stephan von Breuning, der 1801 nach Wien gekommen war, wieder an Bedeutung. Breuning wurde im September 1826 Mitvormund des Neffen Karl und kümmerte sich um Beethoven in den Monaten seiner Todeskrankheit. Ludwig van Beethovens Bruder Johann hatte es als Apotheker in Wien zu einigem Wohlstand gebracht. Der nie besonders enge Kontakt der Brüder intensivierte sich, als Beethoven sich von Johann 1822 eine größere Summe lieh. In den folgenden Jahren zog der Komponist den erfolgreichen Geschäftsmann immer wieder als Berater in Geldangelegenheiten heran. Die Entscheidung des Appellationsgerichts am 8. April 1820, die Beethoven endgültig zum Vormund seines Neffen Karl bestimmte unter der Bedingung, dass ein Mitvormund ihn unterstützte, konnte die fortgesetzten Spannungen zwischen Onkel und Neffe nicht beenden. Am 6. August 1826 unternahm Karl einen Suizidversuch, der zum Rücktritt Beethovens von der Vormundschaft führte. Schon seit etwa seinem 30. Lebensjahr litt Beethoven häufig an Krankheiten. Es sind Schilderungen unterschiedlicher Symptome wie Durchfall, Leibschmerzen, Koliken, Fieberzustände oder Entzündungen überliefert. Als Ursachen kommen zum einen akute Erkrankungen in Betracht, zum anderen werden eine oder mehrere chronische Erkrankungen als Hauptursache genannt. Unter anderem werden eine Bleivergiftung, Brucellose und übermäßiger Alkoholgenuss vermutet. Ob nur eine einzige oder mehrere verschiedene Ursachen für Beethovens gesundheitliche Probleme verantwortlich waren, ließ sich bis in die heutige Zeit nicht zweifelsfrei feststellen. Beethovens Biografen haben festgehalten, dass der Künstler regelmäßig billigen Weißwein trank, der von den Winzern damals mit Bleizucker statt mit teurem Rohrzucker gesüßt wurde. Die Knochen und auch das Haar von Beethoven enthalten Blei und zwar in einer Konzentration, die selten gemessen wurde: „Wir haben mehr als 20.000 Patienten untersucht und bei allen den Bleigehalt im Blut und in den Haaren gemessen. Darunter waren nur acht Menschen die vergleichbare Bleiwerte hatten. Alle acht sind schwer krank und ihre Symptome ähneln denen von Beethoven. Das Blei muss nicht die einzige Ursache für Beethovens Krankheit und frühen Tod sein, aber mit Sicherheit hat das giftige Metall seine Beschwerden verstärkt.“ Mit zunehmendem Alter mehrten sich Häufigkeit und Intensität der Krankheitszustände. Im Sommer 1821 kündigte sich durch eine schwere Gelbsucht eine Leberzirrhose an. Beethoven suchte Linderung der Beschwerden in Bäder- und Landaufenthalten. Sein letzter führte ihn am 29. September 1826 – zusammen mit seinem Neffen – auf das Landgut seines Bruders Johann nach Gneixendorf. Auf der Rückreise nach Wien, die Anfang Dezember bei nasskaltem Wetter im offenen Wagen stattfand, zog sich Beethoven eine Lungenentzündung zu. Kurz nach der Genesung zeigten sich mit Wasseransammlungen in Beinen und Unterleib sowie einer Gelbsucht schwere Symptome der Leberzirrhose, so dass Beethoven das Krankenbett nicht mehr verlassen konnte. Nach mehreren Punktionen und erfolglosen Behandlungsversuchen verschiedener Ärzte starb Beethoven am 26. März 1827 im Alter von 56 Jahren. Sein letzter Arzt war Andreas Ignaz Wawruch. Die Beisetzung auf dem Währinger Ortsfriedhof fand am 29. März unter großer Anteilnahme der Wiener Bevölkerung statt. Ungefähr 20.000 Personen sollen am Trauerzug teilgenommen haben. Die von Franz Grillparzer verfasste Grabrede sprach der Schauspieler Heinrich Anschütz. Franz Schubert, der Beethoven nur ein Jahr später ins Grab folgen sollte, erwies ihm neben Grillparzer als einer der 36 Fackelträger die letzte Ehre. Beethovens Leichnam wurde zweimal exhumiert: 1863, um die Gebeine zu vermessen und den Schädel zu fotografieren; 1888, um sein Skelett – erneut unter großer öffentlicher Anteilnahme – am 22. Juni 1888 in den Ehrenhain auf dem Wiener Zentralfriedhof umzubetten.
18.12. Virgilio CARBONARI: 95. Geburtstag

Er begann seine Karriere Anfang der fünfziger Jahre an kleineren italienischen Theatern (u.a. am Teatro Donizetti Bergamo 1956), sang aber auch bereits 1953 und 1955-56 am Teatro Comunale Florenz (Mesner in »Tosca«, Talpa in »Il Tabarro«, Benoît in »La Bohème«), 1956 am Théâtre de la Monnaie Brüssel. 1959 erreichte er die Mailänder Scala (Antrittsrolle: Alcindoro in »La Bohème«), an der er nun bis 1975 ständig in zahlreichen Comprimario-Partien zu finden war. So sang er an der Scala u.a. den Dancairo in »Carmen«, den Talpa, den Mesner, den Mathieu in »Andrea Chénier« von Giordano, den Alessio in Bellinis »La Sonnambula«, den Naturgelehrten in »Doktor Faust« von Busoni, den Alcalde in »La forza del destino«, den Yamadori in »Madame Butterfly«, den Marcovaldo in »La Battaglia di Legnano« von Verdi, den Marullo im »Rigoletto«, den Mandarin in »Turandot«, den Hirten in »Debora e Jaele« von Pizzetti, den Faor in Cherubinis »Alì Baba«, den Hanezo in Mascagnis »L‘Amico Fritz«, den Sid in »La fanciulla del West«, den Fiorello im »Barbiere di Siviglia«, den Leutoldo in Rossinis »Wilhelm Tell«, den De Brigode in »Madame Sans-Gêne« von Giordano, den Wirt in »Manon« von Massenet und den Lowitzki in »Boris Godunow«. Am 23.3.1961 wirkte er hier als Malaguì in der Uraufführung der Oper »Il Calzare d’Argento« von Pizzetti mit, im gleichen Jahr auch in der italienischen Erstaufführung der Oper »A Midsummer Night’s Dream« von B. Britten (als Starveling). Am 5.4.1962 wirkte er an der Scala in der Uraufführung der Oper »Il buon soldato Svejk« von Guido Turchi mit, am 1.3.1965 in der Uraufführung der Oper »Clittenestra« von Pizzetti, 1966 in der italienischen Erstaufführung von Janáceks »Aus einem Totenhaus« (als Tschekunow). In den Jahren 1960-69 erschien er regelmäßig in derartigen Partien bei den Festspielen in der Arena von Verona (Marullo, Alcindoro). Er setzte gleichzeitig seine Bühnentätigkeit an den übrigen italienischen Opernhäusern fort, darunter am Teatro Comunale Bologna, am Teatro Regio Parma und am Teatro Margherita Genua, gastierte aber auch oft im Ausland, so am Gran Teatre del Liceu in Barcelona (1960) und an der Staatsoper von Wien (1958 als Mesner). Von den vielen Partien, die in seinem Repertoire anzutreffen waren, ist noch der Fra Melitone in »La forza del destino« von Verdi zu nennen. 1983 trat er letztmalig an der Mailänder Scala als Notar in »Gianni Schicchi« auf. Er starb 1988 in Ivi.
Schallplatten: Er wirkte in vielen Gesamtaufnahmen von Opern in seinen Comprimario-Rollen mit, auf Decca in »Macbeth«, »La Traviata«, »La forza del destino«, »Madame Butterfly«, »La Fanciulla del West« von Puccini und »Fedora« von Giordano, auf DGG in »La Bohème«, »La Traviata« und »Rigoletto«, auf HMV in »Rigoletto« und »La forza del destino«, auf RCA in »Madame Butterfly«, »La forza del destino« und »Rigoletto«, auf Ricordi nochmals im »Rigoletto«.
18.12. Rita STREICH: 100. Geburtstag

Sie kam als Kind nach Deutschland und ließ ihre Stimme durch Willi Domgraf-Fassbaender, Maria Ivogün und Erna Berger in Berlin ausbilden. Sie debütierte 1943 am Stadttheater von Aussig (Ùsti nad Labem) als Zerbinetta in »Ariadne auf Naxos« von R. Strauss. 1946 wurde sie an die Staatsoper Berlin berufen, wo sie als Olympia in »Hoffmanns Erzählungen« und als Blondchen in Mozarts »Entführung aus dem Serail« ihre ersten großen Erfolge hatte. Bis 1950 blieb sie an der Staatsoper Berlin und wechselte dann an die Städtische Oper Berlin, der sie bis 1953 angehörte. 1952-53 wirkte sie bei den Festspielen von Bayreuth als Waldvogel im »Siegfried« und als Blumenmädchen im »Parsifal« mit. 1953 wurde sie Mitglied der Staatsoper von Wien, an der sie bis 1972 in zwanzig Partien auftrat (als Olympia, als Rosina im »Barbier von Sevilla«, als Susanna in »Figaros Hochzeit«, als Papagena und als Königin der Nacht in der »Zauberflöte«, als Blondchen und als Konstanze in der »Entführung aus dem Serail«, als Gilda im »Rigoletto«, als Adele in der »Fledermaus«, in der Titelpartie der Operette »Giroflé-Giroflá« von Lecocq, als Zerline im »Don Giovanni«, als Sophie im »Rosenkavalier«, als Zerbinetta, als Despina in »Così fan tutte«, als Page Oscar in Verdis »Maskenball«, als einer der Engel im »Palestrina« von H. Pfitzner, als italienische Sängerin im »Capriccio« von R. Strauss, als eine der Mägde in »Daphne« von R. Strauss, als Waldvogel und als Hirt im »Tannhäuser«). In der Londoner Festival Hall sang sie (mit dem Ensemble der Wiener Staatsoper) 1954 die Zerbinetta und die Susanna. Seit 1954 trat sie bei den Festspielen von Salzburg in Erscheinung. Hier sang sie 1954 das Ännchen im »Freischütz«, 1954-55 die Najade in »Ariadne auf Naxos«, 1956 die Königin der Nacht und die Zerline im »Don Giovanni«, 1957 die Despina, am 17.8.1959 die Titelrolle in der Uraufführung der Oper »Julietta« von Heimo Erbse. 1955-60 und 1965-67 hörte man sie hier in Mozart-Konzerten. 1954 gastierte sie an der Oper von Rom als Sophie. Glänzende Erfolge hatte sie an der Mailänder Scala (1959 als Blondchen), an der Covent Garden Oper London (1954), an der Oper von Chicago (1960 als Susanna) sowie bei den Festspielen von Glyndebourne (1958 als Zerbinetta) und Aix-en-Provence. Ihr USA-Debüt fand 1957 an der San Francisco Opera als Sophie statt; sie sang dort auch die Zerbinetta in der lokalen Premiere von »Ariadne auf Naxos« und die Despina. Sie unternahm Konzerttourneen durch Japan, Australien und Neuseeland und trat gegen Ende ihrer Karriere, vor allem in Frankreich, in Liederabenden auf. Brillante, virtuos geführte Koloraturstimme, besonders als Mozart- und Richard Strauss-Interpretin gerühmt; auch im Konzert- und Lied-Repertoire gefeiert. 1974 wurde sie zur Professorin an der Folkwang-Musikhochschule in Essen ernannt, 1976 erhielt sie eine Professur an der Musikhochschule von Wien. Seit 1983 war sie Leiterin des Centre du Perfectionnement d’Art Lyrique in Nizza. Sie wirkte in zahlreichen Filmen mit; verheiratet mit dem Regisseur Dieter Berger. Sie starb 1987 nach langer Krankheit in Wien.
Viele Schalplatten bei DGG (»Orpheus und Eurydike«, »Hänsel und Gretel«, »Die Entführung aus dem Serail«, »Die Zauberflöte«, »La Bohème«, »Der Freischütz«, »Der Rosenkavalier«, »Bastien und Bastienne«), Philips (»Figaros Hochzeit«), BASF (»Hoffmanns Erzählungen«), Decca (»Ariadne auf Naxos«), Columbia (»Ariadne auf Naxos«, »Die Fledermaus«), Nixa (»Tannhäuser«), Urania (»Hoffmanns Erzählungen«), Pathé (»Le nozze di Figaro«), Electrola (»Der Zarewitsch« von Lehár, »Eine Nacht in Venedig« von J. Strauß, »Der Bettelstudent« von Millöcker), RCA (»Boccaccio« von F. von Suppé, 1949), Koch/Schwann (Ännchen im »Freischütz«, Westdeutscher Rundfunk Köln, 1955). Auf Discocorp erschien ein Rundfunkmitschnitt des »Don Giovanni« (Köln, 1955), auf Foyer als Waldvogel im »Siegfried« (Bayreuth, 1953), auf Cetra Opera Live »Der Freischütz« aus Salzburg (1956), Aufnahmen auf Melodram (»Die Fledermaus«) und Memories (»Undine« von Lortzing), auf Etcetera Duette mit Maureen Forrester.
18.12. Edmond de STOUTZ: 100. Geburtstag
Zunächst hatte er in Zürich Rechtswissenschaften studiert, dann aber zur Musik gewechselt und an der Hochschule für Musik und Theater in Zürich, sowie in Salzburg und Wien Violoncello, Klavier, Oboe, Schlagzeug und Komposition gelernt. Er spielte zwei Jahre als Cellist und Schlagzeuger im Tonhalle-Orchester Zürich und gründete 1945 eine sogenannte Hausorchester-Vereinigung. Aus dieser ging 1951 das Zürcher Kammerorchester, dessen Leitung de Stoutz bis 1996 innehatte. 1962 gründete er zudem den Zürcher Konzertchor.
De Stoutz war bekannt dafür, in seinen Konzertprogrammen immer wieder auf Schweizer Komponisten zurückzugreifen, denen er auch immer wieder Kompositionsaufträge zukommen ließ. So war er auch für mehrere Uraufführungen Schweizer Werke verantwortlich, unter anderem von Frank Martin, Peter Mieg, Paul Müller-Zürich oder Rolf Urs Ringger. De Stoutz wurde 1965 mit der Hans-Georg-Nägeli-Medaille der Stadt Zürich ausgezeichnet. Er erhielt zudem den Preis der Doron-Stiftung und 1991 den Freiheitspreis der Max Schmidheiny-Stiftung. Er starb 1997 in Zürich. Er fand auf dem Privatfriedhof Hohe Promenade seine letzte Ruhestätte.
20.12. Hildegard RANCZAK: 125. Geburtstag

Ausgebildet am Konservatorium der Stadt Wien durch Irene Schlemmer-Ambros. Sie debütierte 1919 am Opernhaus von Düsseldorf als Pamina in der »Zauberflöte« und war bis 1923 dort im Engagement. 1923-25 am Opernhaus von Köln, 1926-28 an der Staatsoper von Stuttgart verpflichtet. 1928 wurde sie an die Münchner Staatsoper berufen, deren Mitglied sie bis 1944 blieb, und an der sie auch später noch gastierte und sich schließlich 1950 als Carmen von ihrem Publikum verabschiedete. Sie wirkte hier 1930 in der Uraufführung der Oper »Die Gespenstersonate« von Julius Weismann mit. Sehr erfolgreiche Gastspiele an den Staatsopern von Dresden (1927) und Wien (1931 als Salome von R. Strauss, 1943 als Aida), an der Covent Garden Oper London (1936 als Salome), an der Grand Opéra von Paris (1937 als Octavian im »Rosenkavalier«) und an der Oper von Rom (1940), auch an der Berliner Staatsoper war sie als Gast zu hören. Bei ihren Gastspielen in Den Haag und in Amsterdam sang sie 1931 die Salome, 1942 die Donna Elvira im »Don Giovanni«, 1943 die Susanna in »Figaros Hochzeit«. Sie sang am 28.10.1942 in der Münchner Uraufführung der Richard-Strauss-Oper »Capriccio« die Rolle der Clairon. Weitere Höhepunkte im reichhaltigen Bühnenrepertoire der Sängerin waren die Färbersfrau in der »Frau ohne Schatten«, die Aithra in »Die ägyptische Helena« und die Zdenka in »Arabella« von R. Strauss, die Minnie in Puccinis »La fanciulla del West«, die Tosca, die Jenufa in der gleichnamigen Oper von Janácek, die Marie in Smetanas »Die verkaufte Braut«, der Komponist in »Ariadne auf Naxos« von R. Strauss, die Titelfigur in »Mignon« von A. Thomas und die Dolly in »Sly« von E. Wolf-Ferrari. Sie war zeitweilig mit dem deutschen Bariton Fritz Schaetzler verheiratet. Sie lebte später in Berg am Starnberger See. Sie starb 1987 in München.
Schallplatten: Telefunken, DGG. Viele Mitschnitte von Opernsendungen des Rundfunks auf BASF (»Il Tabarro« von Puccini, Stuttgarter Rundfunk, 1938), Historia und Preiser.
21.12. Victor de NARKÉ: 90. Geburtstag
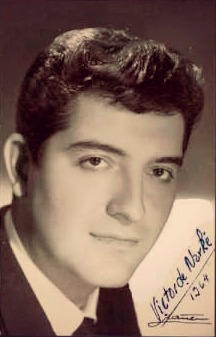
Er war der Sohn des Bassisten Jorge Dantón (* 1905, † 5.12.1986 Buenos Aires, also zwei Tage vor seinem Sohn), der in den Jahren 1940-54 am Teatro Colón Buenos Aires eine erfolgreiche Bühnenkarriere gehabt hatte. Victor de Narké debütierte 1952 (nach anfänglichem Medizinstudium und Ausbildung der Stimme in der Opernschule des Teatro Colón durch Roberto Kinsky und durch Edytha Fleischer) ebenfalls am Teatro Colón und blieb während seiner Karriere, die bis zu seinem Tod dauerte, an diesem Opernhaus tätig. Er spezialisierte sich besonders auf das Wagner-Fach und hatte seine größten Erfolge in Partien wie dem Landgrafen im »Tannhäuser«, dem König Heinrich im »Lohengrin«, dem König Marke in »Tristan und Isolde« und dem Gurnemanz im »Parsifal«, sang daneben aber ein vielgestaltiges Repertoire auf der Bühne wie im Konzertsaal. Am 24.7.1964 wirkte er am Teatro Colón in der Uraufführung der Oper »Don Rodrigo« von Alberto Ginastera mit. Auch in Europa konnte er an diese Erfolge in seiner argentinischen Heimat anknüpfen und war u.a. zu Gast an den Opernhäusern von Zürich (1960-61 als Sarastro in der »Zauberflöte«, als Titurel im »Parsifal«, als alter Hebräer in »Samson et Dalila« von Saint-Saens und als Snug in »Ein Sommernachtstraum« von B. Britten) und Nizza, am Gran Teatre del Liceu in Barcelona, am Teatro Real Madrid (1966), beim Wexford Festival (1967), in Genf (1962 Mönch in Verdis »Don Carlos«, 1964 Abimélech in »Samson et Dalila« von Saint-Saens und Titurel, 1967 als Colline in »La Bohème«, 1969 Arkel in »Pelléas et Mélisande«, 1970 Gremin in »Eugen Onegin«, 1972 Gobrias in »Belshazzar« von Händel), Rio de Janeiro, Santiago de Chile, Montevideo und bei den Festspielen von Glyndebourne (1963 im »Fidelio«). Seit 1966 trat er mehrfach in London als Konzertsänger auf. Man schätzte ihn nicht zuletzt als Liedersänger. Als letzte Partie sang er 1986 am Teatro Colón Buenos Aires den Titurel. Er starb am 7.12.1986 in Buenos Aires.
Schallplatten: Columbia (»El retablo de Maese Pedro« von de Falla), HMV (»La Vida breve« von de Falla).
21.12. André TURP: 95. Geburtstag
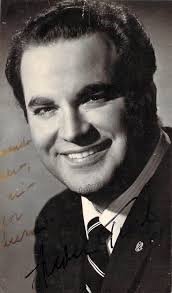
Er war zuerst in Montreal Schüler von Edouard J. Woolley und Frank H. Rowe und trat dort 1950 bei der Montreal Variétés Lyriques-Company in Operetten auf. Nachdem er bereits in einem Konzert in der New Yorker Carnegie Hall aufgetreten war, sang er 1955 in New Orleans in »Gianni Schicchi« von Puccini. 1956 sang er in Montreal in der Oper »Médée« von Cherubini als Partner von Eileen Farrell. Im gleichen Jahr gastierte er in New York in der Offenbach-Operette »La Grand Duchesse de Gerolstein«. Weitere Ausbildung der Stimme durch Luigi Marletta und Mme. Vita in Mailand. Er hatte dann große Erfolge als lyrischer Tenor, vornehmlich in England, wo er nach seinem Debüt 1960 als Edgardo in »Lucia di Lammermoor« acht Jahre hindurch an der Londoner Covent Garden Oper auftrat. 1961 sang er bei den Festspielen von Glyndebourne den Toni Reischmann in H.W. Henzes »Elegie für junge Liebende«. Beim Empire State Music Festival sang er 1960 in der Händel-Oper »Semele«. Er gastierte 1961 mit dem Ensemble der Covent Garden Oper beim Edinburgh Festival (als Edgardo und als Pylade in Glucks »Iphigénie en Tauride«). Er trat 1964 an der Scottish Opera Glasgow als Faust von Gounod auf und gastierte in Frankreich an der Grand Opéra Paris und 1962 an der dortigen Opéra-Comique (als Edgardo). An der Pariser Grand Opéra bewunderte man seine Gestaltung der Titelrolle in Massenets »Werther«, in der er insgesamt mehr als 500mal auf der Bühne stand. Gastspiele und Konzerte in den Musikzentren in Europa und in Amerika, bei denen er in sieben verschiedenen Sprachen seine Partien zum Vortrag bringen konnte. So war er u.a. zu Gast in Rio de Janeiro, Lissabon, Barcelona und Marseille.1973 sang er an der City Opera New York und danach auch an europäischen Theatern den Hoffmann in »Hoffmanns Erzählungen«. Zu seinen großen Bühnenpartien gehörten auch der Don José in »Carmen«, der Julien in Charpentiers »Louise und der Chevalier de la Force in »Dialogues des Carmélites« von Poulenc. 1983 sang er als Abschiedspartie in Montreal den Macduff in Verdis »Macbeth«, während sein Sohn, der Tenor Richard Turp, den Malcolm übernommen hatte. 1980-88 übte er eine Lehrtätigkeit am Konservatorium von Montreal aus. Er starb 1991 in Montreal.
Schallplatten: Columbia-CBS (Querschnitt durch »Medea« von Cherubini mit Eileen Farrell), RCA (»Roméo et Juliette« von Gounod), MRF, (»I gioielli della Madonna« von Wolf-Ferrari, »Pénélope« von Fauré), Bruno Walter Society (Faust in »La damnation de Faust« von Berlioz).
21.12. Paul HÖFFER: 125. Geburtstag
Er studierte zunächst bei Georgii, Bölsche und Abendroth an der Kölner Musikhochschule. Nach einer Unterbrechung durch den Ersten Weltkrieg setzte er sein Studium ab 1920 an der Musikhochschule Berlin bei Franz Schreker fort. Ab 1923 unterrichtete er dort selbst Klavier. Von 1930 an unterrichtete der zudem Komposition und Musiktheorie. 1933 wurde er zum Professor ernannt. Obwohl er 1935 von der NS-Kulturgemeinde auf die Liste der „Musik-Bolschewisten“ gesetzt wurde, erhielt er bei den Olympischen Sommerspielen 1936 in Berlin die Goldmedaille für sein Chorwerk Olympischer Schwur. Während ihn das Amt Rosenberg als „atonalen Komponisten“ bezeichnete, wurde Höffer weiterhin von Goebbels protegiert und erhielt 1939 5.000 Mark für die Auftragskomposition eines Orchesterwerks. 1944 schrieb er im Auftrag der Goebbels unterstellten Reichsstelle für Musikbearbeitungen das Oratorium Mysterium der Liebe. In der Endphase des Zweiten Weltkrieges nahm ihn Hitler im August 1944 in die Gottbegnadeten-Liste der wichtigsten Komponisten auf, was ihn vor einem Kriegseinsatz bewahrte. 1945 wurde Höffer Direktor des Internationalen Musikinstituts Berlin, an dem u. a. Sergiu Celibidache unterrichtete. 1948 wurde Höffer Direktor der Musikhochschule Berlin. Paul Höffer starb Ende August 1949 im Alter von 53 Jahren in Berlin. Sein Grab befindet sich auf dem landeseigenen Friedhof Heerstraße in Berlin-Westend (Grablage: II-W12-245). Neben ihm ruht seine dritte Ehefrau Linde geb. von Winterfeld (1919–93). Eine Gedenktafel am Olympiastadion Berlin erinnert an ihn.
22.12. Betty DASNOY: 125. Geburtstag
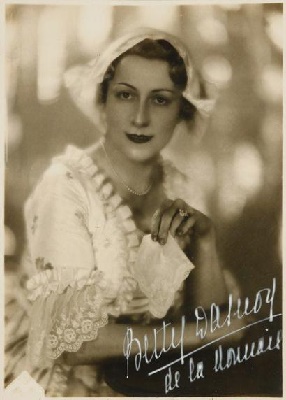
Ihre Ausbildung erfolgte an der Musikschule St. Josse-Schaerbeek, u.a. bei L. Swolfs und Fr. Rasse. Ihr Debüt fand 1923 in Ostende als Marguerite im »Faust« von Gounod statt. Sie wurde dann für einige Jahre an die Königliche Oper Antwerpen engagiert, wo sie mehrere Rollen in flämischen Erstaufführungen sang (»Sadko« und »Der goldene Hahn« von Rimsky-Korssakow, »Die ägyptische Helena« von R. Strauss). Ende der zwanziger Jahre wurde sie für zwei Spielzeiten Mitglied der Oper von Nizza und gastierte anschließend an französischen Provinzbühnen, u.a. in Bordeaux, Marseille, Rouen und Straßburg sowie 1933 an der Opéra-Comique Paris als Tosca. Es schloss sich eine Tournee durch Nordafrika an, dann wieder Auftritte an belgischen Theatern. Für die Jahre 1935-37 war sie Mitglied des Théâtre de la Monnaie Brüssel. Hier sang sie in der französischsprachigen Erstaufführung von Wagner-Régenys »Der Günstling« 1936 die Partie der Maria Tudor. Neben ihrem Wirken auf der Bühne entfaltete sie eine umfangreiche Tätigkeit als Konzertsängerin; seit 1932 bekleidete sie eine Gesangsprofessur am Konservatorium von Lüttich. Aus ihrem Repertoire für die Bühne sind noch die Salomé in »Hérodiade« von Massenet, die Titelfigur in dessen Oper »Thaïs« und die Reinilde in den flämischen Oper »De Herbergprinses« von Jan Blockx zu nennen. Sie starb 1972 in Brüssel.
23.12. Willi GOHL: 95. Geburtstag
Er ließ sich zuerst zum Lehrer ausbilden. Später studierte er an der Musikhochschule Zürich Klavier und Schulmusik und ließ sich im In- und Ausland zum Dirigenten ausbilden. Im Orchester der Kammermusiker Zürich war er Solo-Cembalist. Nach zehn Jahren Unterricht an der damaligen Töchterschule Zürich widmete er sich ausschließlich dem Beruf des Musikers. 1954 gründete er den Singkreis Zürich, mit dem er an zahlreichen offenen Singen, Symposien, Konzerten und Veranstaltungen der Föderation Europa Cantat teilnahm. 1959-86 leitete er die Musikschule und das Konservatorium Winterthur, das zu einer der bedeutendsten Musikhochschulen wurde. Bekannt wurde er vor allem durch seine offenen Singen in der ganzen Schweiz, die oft im Radio übertragen wurden sowie die kommentierten Sinfoniekonzerte. Er war Ehrenpräsident des Schweizer Musikrats. 1975 brachte er zusammen mit Anne Diekmann im Diogenes-Verlag «Das Grosse Liederbuch» mit 204 deutschen Volks- und Kinderliedern heraus. Illustriert wurde es von Tomi Ungerer. Sein bekanntester Kanon «Ein heller Morgen ohne Sorgen» ist in das schweizerische Liedgut eingegangen. 1952 heiratete Gohl die Sängerin Verena Müller. Oft traten die beiden zusammen auf: sie als Solistin in seinen Chorkonzerten, er als Pianist an ihren Liederabenden. Die Beiden erhielten 1980 den Kulturpreis der Stadt Winterthur. Ihre drei Töchter und zwei Söhne sind alle ebenfalls musikalisch tätig. Sein Sohn Michael ist anerkannter Chorleiter und Leiter der Musikschule in Zollikon. Teese Gohl arbeitet in den USA als Komponist, Dirigent und Produzent für Filmmusik. Käthi Gohl ist als Cellistin international tätig. Seine letzte Lebenszeit verbrachte Willi Gohl in einer Pflegeeinrichtung in Küsnacht, wo er 2010 im Alter von 84 Jahren verstarb.
24.12. Emanuela FRANK: 150. Geburtstag
Sie war die Tochter eines Kaiserlich-Königlich österreichischen Beamten und erhielt ihrer Ausbildung zur Sängerin am Konservatorium von Prag, wo sie Schülerin von Franz Vogel war. Sie sang zu Beginn ihrer Karriere 1886-87 am Opernhaus von Köln, dann 1887-88 an der Deutschen Oper Rotterdam, 1888-89 am Stadttheater von Zürich und 1889-91 am Hoftheater von Kassel, seit 1892 war sie an der Bayerischen Hofoper in München im Engagement. 1900 folgte sie einem Ruf an das Opernhaus von Leipzig, an dem sie den Übergang ins hochdramatische Sopranfach vollziehen wollte. Sie musste diesen Plan jedoch aufgeben und kam 1901 nach München zurück. Von dort aus setzte sie jetzt ihre Karriere mit Gastspielen und Konzerten fort. Ihre Bühnengastspiele führten sie an das Opernhaus von Frankfurt a.M. (1901), an die Wiener Hofoper (1902 als Adriano in »Rienzi« von R. Wagner), an die Hoftheater von Weimar (1901) und Hannover (1903) wie an das Stadttheater von Bremen (1902). Als Höhepunkte hatte ihr Bühnenrepertoire Partien wie die Ortrud im »Lohengrin«, die Fides in Meyerbeers »Der Prophet«, den Titelhelden in »Orpheus und Eurydike« von Gluck, die Azucena im »Troubadour«, die Amneris in »Aida«, die Eglantine in Webers »Euryanthe«, die Leonore im »Fidelio«, die Rachel in »La Juive« von Halévy, die Fricka wie die Waltraute im Nibelungenring und die Mutter in »Hänsel und Gretel« aufzuweisen. Sie starb 1940 in München.
24.12. Giovanni TAGLIAPIETRA: 175. Geburtstag

Er entstammte einer alten venezianischen Familie, studierte Schiffbau und später Architektur, zuerst in Venedig, dann an der Universität von Padua, und erwarb darin einen akademischen Grad. Dann ließ er jedoch seine Stimme bei Giovanni Corsi ausbilden. Nach ersten Erfolgen an italienischen Bühnen kam er 1874 nach Nordamerika. Hier wurde er Mitglied einer Operntruppe, die der Impresario Max Strakosch zusammengestellt hatte, und mit der er große Tourneen, vor allem in Südamerika, unternahm. Dabei sang er 1876 in Caracas in einer Oper, die durch die weltbekannte venezolanische Pianistin Teresa Careño dirigiert wurde. Darauf heirateten die beiden Künstler, doch kam es später wieder zu deren Trennung. 1902 heiratete dann Teresa Careño in vierter Ehe einen jüngeren Bruder des Sängers, Arturo Tagliapietra. Giovanni Tagliapietra wirkte nach Aufgabe seiner Bühnenkarriere als Pädagoge in New York, wo er 1921 starb.
25.12. Eugenio FERNANDI: 95. Geburtstag
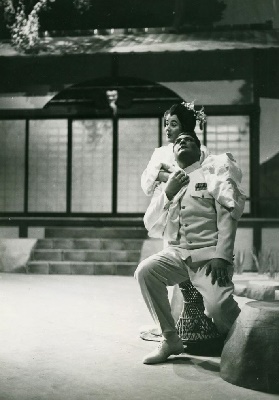
Mit Antonietta Stella in Madama butterfly
Er entstammte einer bäuerlichen Familie. Ausbildung in Turin bei Aureliano Pertile, dann in der Opernschule der Mailänder Scala. Er sang zunächst an der Scala kleinere Tenorpartien; sein Debüt erfolgte dort am 25.3.1953 in der Uraufführung der Oper »Mas‘aniello« von Jacopo Napoli. Er wirkte hier auch am 24.3.1954 in der Uraufführung der Oper »La Figlia del diavolo« von Virgilio Mortari (in der Partie des Giovanni Battista) mit. An der Scala trat er 1958 nochmals als Pinkerton in »Madame Butterfly« auf. 1955 sang er in Reggio Emilia den Herzog im »Rigoletto«. Nach ersten Erfolgen an den großen italienischen Bühnen (seit 1956 u.a. am Teatro Fenice Venedig und am Teatro San Carlo Neapel) wurde er 1958 an die Metropolitan Oper New York verpflichtet (Debüt als Pinkerton). Hier trat er in den Spielzeiten 1957-62, 1966-67, 1968-69 und 1970-71 in 95 Vorstellungen und in 13 verschiedenen Rollen auf: als Edgardo in »Lucia di Lammermoor«, als Herzog im »Rigoletto«, als Cavaradossi in »Tosca«, als Rodolfo in »La Bohème«, als Alfredo in »La Traviata«, als Don Carlos, als italienischer Sänger im »Rosenkavalier«, als Faust von Gounod, als Ismaele in Verdis »Nabucco«, als Radames in »Aida«, als Enzo in »La Gioconda« von Ponchielli und als Arrigo in »I Vespri Siciliani« von Verdi. 1957 gastierte er bei den Festspielen in den Thermen des Caracalla in Rom als Faust von Gounod. 1957-64 hatte er auch seine Erfolge an der Staatsoper Wien (als Cavaradossi, als Rodolfo, als Radames, als Don Carlos, als Herzog im »Rigoletto«, als Alfredo, als Pinkerton, als Riccardo in Verdis »Maskenball« und als Faust von Gounod in insgesamt 39 Vorstellungen). 1958 sang er in Zürich den Cavaradossi in »Tosca« mit Birgit Nilsson in der Titelrolle. Den Titelhelden in Verdis »Don Carlos« sang er 1958 und 1960 bei den Salzburger Festspielen. Er gastierte auch weiter in Italien, so 1963 am Teatro San Carlo Neapel (als Edgardo), 1964 am Teatro Petruzzelli Bari, 1965 am Teatro Comunale Florenz (als Cavaradossi), 1965 in San Remo (als Pinkerton) und 1966 am Teatro Fenice Venedig. 1964 sang er in einem Konzert im Vatikan in Rom vor Papst Paul VI. ein Solo in dem Oratorium »Il Giudizio Universale« von Lorenzo Perosi, im November des gleichen Jahres in einer Eurovisons-Sendung aus Paris das Tenorsolo im Requiem von Verdi. In Nordamerika trat er 1969 an der Oper von New Orleans als Pollione in »Norma« und als Foresto in »Attila« von Verdi auf, an der Oper von Santiago de Chile 1970 als Samson in »Samson et Dalila« von Saint-Saëns, eine Partie, die er bereits 1966 an der Opéra du Rhin Straßburg übernommen hatte (wo er auch 1965 als Radames gastierte). Bedeutender Vertreter des Repertoires für das Lirico Spinto-Fach. Seine Karriere kam zu Beginn der siebziger Jahre zum Ausklang. Er lebte dann ganz zurückgezogen in den USA. Er starb 1991 in New Jersey.
Schallplatten: Columbia (vollständige Oper »Turandot« als Partner von Maria Callas), HMV (Verdi-Requiem.) Mitschnitte von Opernaufführungen auf Replica (»Lucia di Lammermoor« zusammen mit Maria Callas), Melodram (»Nabucco«), Cetra Opera Live (»Don Carlos« von Verdi), Mondo Musica (»Giulio Cesare« von Händel, Teatro Fenice Venedig 1966).
25.12. Viktor KOČI: 100. Geburtstag
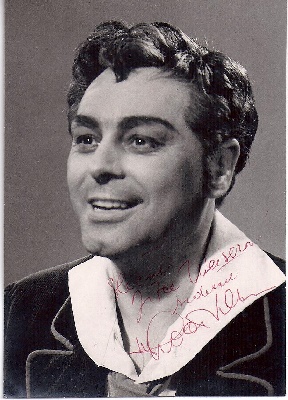
Seine Ausbildung erfolgte durch die Pädagogen J. Berlik und M. Lang in Prag. 1952 debütierte er am Theater von Plzen, von wo aus er 1955 ans Nationaltheater von Prag engagiert wurde, dem er bis in die achtziger Jahre hinein angehörte. Hier sang er eine große Zahl von Tenorpartien aus dem lyrischen Fachbereich wie den Don Ottavio im »Don Giovanni«, den Rodolfo in »La Bohème«, den Cavaradossi in »Tosca«, den Vitek in Smetanas »Dalibor«, den Kudrjas in »Katja Kabanowa«, den Stewa in »Jenufa«, den Cheravin in Janáceks »Aus einem Totenhaus«, den Michel in »Julietta« von B. Martinù und den Albert Herring in der gleichnamigen Oper von B. Britten. Er gab Gastspiele, zum Teil mit dem Ensemble des Nationaltheaters Prag, in Holland, Finnland, Italien und an der Komischen Oper Berlin. Er starb 2005 in Prag.
Wahrscheinlich sind Aufnahmen auf Supraphon vorhanden.
25.12. Joseph BOULOGNE: 175. Geburtstag
Seine genaue Herkunft war lange umstritten. Man geht heute davon aus, dass er Weihnachten 1745 zur Welt kam. Die Annahme der Association du Chevalier de Saint-Georges, es handele sich um den illegitimen Sohn von George de Bologne de Saint-Georges (1711–74), scheint zu stimmen. Die Mutter war eine 16-jährige Sklavin, geboren in Guadaloupe mit Namen Anne Nanon, die schon zehn Jahre in Dienst war und für ihre Schönheit vielfach gerühmt wurde. 1747 wurde George de Bologne während eines Besuches bei seinem Onkel Samuel de Bologne zu einem Duell aufgefordert. Dabei wurde sein Gegner verletzt, konnte aber zunächst ohne Hilfe nach Hause gehen. Drei Tage später starb der Mann, wahrscheinlich eher an einer Tetanusinfektion als an der Wunde selbst, und George wurde des Mordes angeklagt. Er floh aus Basse-Terre und wurde am 31. März 1748 in absentia verurteilt, „gehängt und zu Tode gedrosselt zu werden am Galgen, der an der Ecke des öffentlichen Platzes in dieser Stadt Basse-Terre errichtet ist“. Alle seine Güter wurden eingezogen. Zwischen September 1748/49 wurde der 3-jährige Joseph von seiner Mutter mitgenommen (mit der „Stiefmutter“ Elisabeth Mérican) nach Frankreich, zunächst nach Bordeaux, dann nach Angoulême, wo sein Onkel Pierre lebte. 1753 wurde Joseph zum zweiten Mal nach Frankreich geschickt. Als Schüler besuchte er das Collège Saint-Louis in Angoulême. 1755 kam die Mutter zusammen mit seinem Vater nach Paris. Als 13-Jähriger erhielt er eine Fechtausbildung in der Fechtschule des Fechtmeisters Nicolas Texier de la Boëssière. Außerdem bekam er eine musikalische Ausbildung, wahrscheinlich beim Violinvirtuosen Pierre Gaviniès. Joseph verwendete ab 1763 den Titel seines Vaters. 1764 wurde er mit 17 Jahren in die „Garde du corps du roi“ in Versailles aufgenommen. Auch in der Musik war er weiter aktiv, Antonio Lolli, Carl Stamitz und der Komponist und Orchesterleiter Francois-Joseph Gossec widmeten ihm einige musikalische Werke. Joseph Bologne, Chevalier de Saint-Georges war wegen seiner guten Manieren und künstlerischen sowie sportlichen Fähigkeiten eine besonders von Frauen umschwärmte Persönlichkeit. Er brillierte in der Pariser Gesellschaft als Schwimmer und Eisläufer. Als Musiker trat er mehrmals mit Baron Karl Ernst von Bagge und Madame de Genlis, die Harfe spielte, auf. Saint-Georges eigentliche musikalische Karriere begann 1769, als er dem Concert des Amateurs (Orchester der Amateure) als erster Violinist beitrat. 1772 erfolgte sein Debüt als Komponist. In der Nachfolge Gossecs übernahm Saint-Georges 1773 die Leitung der Concert des Amateurs, die er bekannt machte. 1774 starb sein Vater in Guadaloupe, und seine Halbschwester erbte die zwei Plantagen. 1775 führte St. Georges als einer der ersten die Symphonie concertante und einige Quatuor concertants ein. 1776 war St Georges als musikalischer Direktor der Académie Royale de musique im Gespräch und plante, diese zu reformieren. Der Widerstand einiger Sängerinnen, die sich weigerten, unter einem Mulatten zu singen, einer Tänzerin mit viel Einfluss bei ihrem Gönner und dadurch geweckte Bedenken des Hofes verhinderten die Berufung. 1777 wurde im Théâtre-Italien seine erste Oper, basierend auf einem Libretto von Pierre Choderlos de Laclos, uraufgeführt, hatte aber vor allem wegen des enttäuschenden Librettos keinen Erfolg. Madame de Montesson lud ihn ein, in ihrem Haus zu wohnen, und Madame de Montalembert in ihrem Privattheater zu spielen. Louis Philippe I. de Bourbon, duc d‘Orléans, ihr Ehemann, ernannte ihn zum Lieutenant de la chasse in Le Raincy. Dort komponiert er seine zweite Oper. Im Sommer 1778 lebte St Georges zwei Monate lang im Appartement des Barons Melchior Grimm und von Louise d‘Épinay, wo auch der junge Mozart wohnte, nachdem seine Mutter am 3. Juli in Paris gestorben war. St. Georges hörte auf Orchesterwerke zu komponieren, dirigierte aber weiterhin sein Orchester. Er musizierte mit der jungen Marie Antoinette im Petit Trianon. 1780 komponierte er seine dritte Oper nach einem Libretto von Félicité de Genlis. 1781 wurde das Orchestre des Amateurs wegen Geldmangel aufgelöst. St George war Mitglied der Freimaurerloge zu den Neun Schwestern, und das von ihm geleitete Orchester der Loge „de la Parfaite Estime et Société Olympique“ mit Sitz im Palais Royal führte die Concerts des Amateurs fort. Mit 65–70 Mitgliedern – teils Profimusikern der Oper, teils gut ausgebildeten Laien – war es das größte Orchester seiner Zeit. St Georges kontaktierte Joseph Haydn für eine Komposition und dessen „Pariser Sinfonien“ (Nr. 82–87), die „Olympique“, wurde unter Leitung des Chevallier de Saint-Georges 1784 uraufgeführt. 1785 wurde St Georges von Louis-Philippe II. Joseph de Bourbon, duc d‘Orléans eingeladen im Palais Royal zu logieren. Dort lernte er Jacques Pierre Brissot kennen, der St Georges 1787 mit einem Geheimauftrag nach London schickte, wo er William Wilberforce, John Wilkes, und Thomas Clarkson kennenlernte. 1788 wurde in Paris die Societé des Amis des Noirs gegründet. Im Mai 1789 war St Georges anwesend bei der Einberufung der Generalstände von 1789, floh aber einige Wochen später nach London. Enttäuscht von Philippe Égalité zog er 1790 nach Lille. St Georges wurde als Hauptmann in die Garde national aufgenommen. Außerdem führte er ein Laienorchester in der Stadt. Als Theobald Dillon von seinen eigenen Soldaten ermordet wurde, dirigierte St Georges abends ein Requiem. Er hatte seit dem 8. September 1792 ein eigenes Kommando mit 1000 Soldaten aus den französischen Kolonien unter seinem Befehl, die „Légion franche de cavalerie des Américains et du Midi“. Thomas Alexandre Dumas war Leutnant unter ihm. Ab Dezember diente er in der Nordarmee unter General Joseph de Miaczynski. Als Charles-Francois Dumouriez im März 1793 bei Neerwinden eine Niederlage erlitt, setzte er sich in seinem Hauptquartier in Saint-Amand-les-Eaux fest. Vier Beauftragte des Konvents und der Verteidigungsminister Pierre Riel de Beurnonville wurden nach Lille geschickt, um seine Führung zu untersuchen. Dumouriez schickte Miaczynski nach Lille, um die Beauftragten zu verhaften. Als General Miaczynski am 2. April in Lille eintraf und St Georges für die Teilnahme an einem Staatsstreich zu gewinnen versuchte, wurde der polnische General verhaftet. Dann versuchte Dumouriez seine Truppen zu überreden, nach Paris einzumarschieren, um die revolutionäre Regierung zu stürzen. Die Beauftragten trafen Dumouriez letztendlich, um ihn nach Paris zu bringen, aber der General weigerte sich, ließ sie nach dem Mittagessen verhaften und an Österreich ausliefern. Fünf Tage später begann die Schreckensherrschaft. Saint-Georges wurde während der Schreckensherrschaft des Wohlfahrtsausschusses im September 1793 denunziert und in Hondainville bei Clermont (Oise) für elf Monate inhaftiert (in Briefen spricht er selbst von 18 Monaten). Im Oktober 1794 kam er frei, erhielt aber kein neues Kommando und wurde ein Jahr später entlassen. Er nutzte 1796 die Gelegenheit, einen Freund nach Santo Domingo in Haiti zu begleiten, wo Francois-Dominique Toussaint L‘Ouverture kurzzeitig ein Regime aus Mulatten errichtet hatte, das Schwarze wie Weiße gleichermaßen verfolgte. Saint-Georges kehrte 1797 enttäuscht nach Paris zurück, wo er zwei Jahre später zurückgezogen und verarmt in der Rue Boucherat No. 13 starb.
2004 wurde das Leben des Künstlers im Schlosspark von Versailles durch den Künstler Bartabas in einem historischen Spektakel inszeniert. 2003 entstand der kanadische Fernsehfilm („Le Mozart noir“) von Raymond Saint-Jean über sein Leben. Eine Straße in Paris wurde nach ihm benannt, und sein Heimatort auf Basse-Terre ehrte ihn ebenfalls mit einer Straße und einem Denkmal. Die zuerst benannte Rue de Chevalier de Saint-Georges auf Guadeloupe nennt als Geburtsjahr 1745, während direkt daneben das Denkmal 1739 angibt. Musikalisch ist Joseph Bologne Chevalier de Saint-Georges in die französische Klassik einzuordnen. Besonders seine Lehrer und Gossec prägten seinen instrumentalen wie kompositorischen Stil; auch Einflüsse der Mannheimer Schule und von Joseph Haydn sind zu erkennen. Seine Musik erinnert wie diejenige von Gossec auch stark an den jungen Mozart – wobei Saint-Georges und Gossec jedoch eher als dessen Vorgänger und Vorbilder anzusehen sind und nicht umgekehrt. Laut Banat soll Saint-Georges einen gewissen Einfluss auf Beethoven gehabt haben. Neben seiner Tätigkeit als Dirigent und Violinist komponierte Saint-Georges 14 Violinkonzerte, 2 Sinfonien, 18 Steichquartette, oder Quatuor concertant, 12 Cembalo- und Violinsonaten, Lieder und 6 Opern. „L’Amant Anonyme“ (1780) ist die einzige Oper, die erhalten blieb. Die 8 Sinfonia concertante (Konzerte für mindestens zwei Solisten und Orchester) gehörte zu von Saint-Georges besonders gepflegten zeitgenössischen musikalischen Formen und sollen Mozart, so wird verschiedentlich angenommen, sehr beeindruckt und inspiriert haben.
26.12. Tugomir ALAUPOVIĆ: 95. Geburtstag
Schüler von Zlatko Sir in Zagreb und von Louis Kaderabek in Prag. Debütierte am Komedija Theater in Zagreb 1953 im »Zigeunerbaron« von J. Strauß. Seit 1955 Mitglied der Kroatischen Nationaloper Zagreb, wo er eine lange erfolgreiche Laufbahn hatte. Gastspiele, zumeist mit dem Ensemble der Oper von Zagreb, an der Nationaloper Belgrad, am Opernhaus von Graz, an der Komischen Oper Berlin, in Amsterdam, Mannheim, Stuttgart, Wiesbaden, Genf (1974 als Skula in »Fürst Igor« von Borodin), Neapel, Bologna, Genua und Triest. Durch einen Vertrag mit dem Stadttheater Klagenfurt viele Jahre hindurch verbunden. Sang eine Vielzahl von Partien für Bass-Bariton, seriöse und komische Rollen wie den Figaro im »Barbier von Sevilla«, den Guglielmo in »Così fan tutte«, den Papageno in der »Zauberflöte«, den Dulcamara in »L’Elisir d’amore«, den Ford im »Falstaff« von Verdi, den Valentin im »Faust« von Gounod, den Beckmesser in »Die Meistersinger von Nürnberg«, den Balstrode in »Peter Grimes« von Benjamin Britten, den Sima in »Ero der Schelm« von Gotovac und den Jeletzky in Tschaikowskys »Pique Dame«. Erfolgreiche Auftritte im Konzertsaal wie im jugoslawischen Fernsehen. Später Gesangpädagoge an der Lisinski-Musikschule in Zagreb. Er starb 2005 in Zagreb.
Aufnahmen auf der jugoslawischen Marke Jugoton. Auf Philips vollständige Oper »Sadko« von Rimsky-Korssakow.
27.12. Sigrid EKKEHARD: 100. Geburtstag

Sie studierte Gesang bei Maja Nissen-Stone in Berlin (1937-38), bei Hedwig Francillo-Kaufmann (1938-41) und nach 1945 bei Lula Mysz-Gmeiner in Schwerin. Sie sang in den Jahren 1943-46 als lyrischer Sopran am Staatstheater Schwerin und folgte 1946 einem Ruf an die Berliner Staatsoper. Bis 1961 wirkte sie an diesem Haus als jugendlich-dramatischer Sopran; gleichzeitig bestand 1954-58 ein Gastvertrag mit der Komischen Oper Berlin. Bei den Händel-Festspielen in Hall/Saale sang sie 1952 in der Oper »Alcina« von G.F. Händel. Sie trat bei Gastspielen am Staatstheater Hannover (1956), am Opernhaus von Zürich (1957 als Titelheldin in »Elektra« von R. Strauss), an der Wiener Staatsoper (1960 ebenfalls als Elektra von R. Strauss), in Paris und Prag, in Köln und Warschau auf. Später lebte sie in West-Berlin, wo sie 1996 starb. Sie sang auf der Bühne Partien wie die Donna Elvira im »Don Giovanni«, die Fiordiligi in »Così fan tutte«, die Agathe im »Freischütz«, die Leonore im »Fidelio«, die Eva in »Die Meistersinger von Nürnberg«, die Sieglinde in der »Walküre«, die Gutrune in der »Götterdämmerung«, die Desdemona im »Otello« von Verdi, die Santuzza in »Cavalleria rusticana«, die Mimi in »La Bohème«, die Butterfly, die Tosca, die Turandot in der gleichnamigen Puccini-Oper, die Marina im »Boris Godunow«, die Carmen, die Marie im »Wozzeck« von A. Berg und die Titelheldin in »Halka« von Moniuszko.
Schallplatten: Eterna (»Turandot« von Puccini, auf Philips in Form eines Querschnitts veröffentlicht).
27.12. Augusto MACHADO: 175. Geburtstag
Er bekam seine erste musikalische Ausbildung in Lissabon bei Joaquim Casimiro und Emílio Daddi und erhielt später Unterricht am Konservatorium seiner Heimatstadt. Schon in jungen Jahren begab er sich nach Paris und studierte bei Albert Lavignac (1846–1916). Im Jahr 1869 wurde sein Bllett Zefireto am Teatro de Sao Carlos in Lissabon aufgeführt; ein Jahr später kam seine Operette O Sol de Navarra am Teatro de Trindade zur ersten Aufführung, aber keines dieser Ereignisse war ein besonderer Erfolg. Dem Komponisten missfiel der vorherrschende Einfluss der italienischen Musik in Lissabon ebenso wie der Einfluss der französisch-orientierten literarischen Kreise. So wandte er sich erneut nach Paris und setzte seine Studien bei Lavignac und Adolphe-Léopold Danhauser (1835–96) fort. Hier lernte er auch die Komponisten Jules Massenet und Camille Saint-Saens kennen, die einen Einfluss auf seinen kompositorischen Stil hatten. Infolge privater Probleme war er gezwungen, nach Lissabon zurückzukehren, und er nahm eine Stellung als Gesangslehrer am dortigen Konservatorium an; er war auch Direktor dieser Institution 1901-10. Für das Teatro da Trindade komponierte er mehrere Operetten und außerdem die symphonische Ode Camões e os Lusíades aus Anlass des 300. Todesjahrs des Nationaldichters Luis de Camoes (1524/25–1580); dieses Werk wurde jedoch nie aufgeführt. Machados erste Oper Lauriane, die 1883 in Marseille uraufgeführt wurde, war erfolgreich und erlebte weitere Aufführungen 1884 am Teatro de São Carlos in Lissabon und 1886 am Teatro Lírico in Rio de Janeiro. Er schrieb noch drei weitere Opern auf Libretti von italienischen Verfassern, die am Teatro de São Carlos aufgeführt wurden, und er war auch von 1889 bis 1892 Direktor dieses Theaters. Augusto Machado unternahm mehrere Versuche, einen portugiesischen Nationaltyp der Operette zu schaffen, besonders mit der Operette Maria da Fonte, doch war ihm damit kein dauerhafter Erfolg beschieden. Nachdem seine erste Oper Lauriane in Lissabon aufgeführt worden war, hatte es den Anschein, dass mit ihm eine Tradition der nationalen Oper beginnen könne. Sein Stil war jedoch stark von französischen Vorbildern beeinflusst, so dass daraus keine national-portugiesische Oper entstanden ist. Machado ist mit seinen späteren Opern dann zur vorherrschenden italienischen Tradition zurückgekehrt. Er starb 1924 in Lissabon.
28.12. Marion BRINER: 85. Geburtstag

Marion Briner mit Giuseppe di Stefano
Sie wurde Balletttänzerin und war 1953-60 als Solotänzerin an der Hamburger Staatsoper, dann 1960-61 am Stadttheater von Luzern und 1961-63 am Theater von Graz engagiert. Obwohl sie als Tänzerin eine erfolgreiche Karriere hatte, wechselte sie ins Gesangsfach und spezialisierte sich auf Operettenpartien. Sie trat als Operettensängerin zuerst 1968-69 am Theater an der Wien in Wien auf und wurde dann an das Theater am Gärtnerplatz in München verpflichtet. Hier debütierte sie 1969 in der Operette »Gasparone« von C. Millöcker und hatte dann als Hanna Glawari in Lehárs »Die lustige Witwe« und als Rosalinde in der »Fledermaus« ihre großen Erfolge in München. Ihr Repertoire war vielseitig und umfasste auch Comprimario-Rollen im Bereich der Oper wie der Operette. Dabei galt sie als begabte Darstellerin auf der Bühne. Sie hatte die Partie der Knusperhexe in »Hänsel und Gretel« gerade einstudiert, als sie durch einen tödlichen Verkehrsunfall 1974 bei München aus ihrer Karriere gerissen wurde.
Schallplatten: Telefunken (Querschnitt »Im weißen Rössl«).
28.12. Bruce YARNELL: 85. Geburtstag
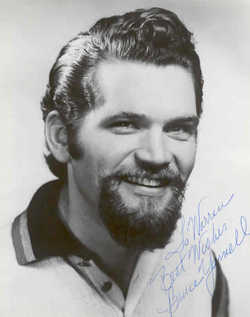
Er hatte 1960 sein Broadwaydebüt als Sir Lionel in der Originalproduktion von Camelot. Danach spielte er in E.Y. Harburgs The Happiest Girl in the World, wofür er 1961 als Teil des Ensembles mit dem Theatre World Award ausgezeichnet wurde. Im selben Jahr erhielt er die Rolle des Chalk Breeson, eine der Hauptrollen in der zweiten Staffel der Westernserie Outlaws. Die Serie wurde nach dem Ende der Staffel eingestellt, woraufhin Yarnell Gastrollen in Fernsehserien annahm. Unter anderem war er in zwei Folgen der Serie Bonanza als Muley Jones zu sehen, in denen er auch sang. 1963 stellte er an der Seite von Jack Lemmon und Shirley MacLaine den Hippolyte in Billy Wilders Irma la Douce dar. Obwohl es sich um eine größere Rolle in einem sehr erfolgreichen, Oscar-prämierten Spielfilm handelte, schlossen sich zunächst keine weiten Filmrollen an. Stattdessen kehrte er 1966 an den Broadway zurück, und trat dort in Annie Get Your Gun neben Ethel Merman in der männlichen Hauptrolle auf. Mit Beginn der 1970er Jahre wandte er sich der Oper zu und wechselte an die San Francisco Opera. Dort debütierte er 1971 als Sharpless in Madame Butterfly und sang bis 1973 mehrere Partien (Tierbändiger, Dr. Goll, Rodrigo, Jack the Ripper) in Alban Bergs Lulu, den Amonasro in Aida, den Pfarrer in der amerikanischen Erstaufführung von G. von Einems Der Besuch der alten Dame, den Scarpia in Tosca, den Rangoni in Boris Godunow, den Dr. Falke in der Fledermaus und den General Boum in Offenbachs Die Großherzogin von Gerolstein. Nach seinem letzten Auftritt als Marcello in La Bohème verunglückte er mit seinem Privatflugzeug. Er und zwei Passagiere kamen am 30. November 1973 kurz nach dem Verlassen des Flughafens von Los Angeles bei dem Absturz in den Santa Monica Mountains ums Leben. Er war verheiratet mit der Sopranistin Joan Patenaude (* 12.9.1937). Seine Schwester Lorene Yarnell (1944-2010) war im Showgeschäft als Schauspielerin, Stepptänzerin und Pantomimin tätig.
28.12. Matja von NIESSEN-STONE: 150. Geburtstag

Sie war von deutsch-russischer Abstammung und erhielt ihre Ausbildung überwiegend durch die große Sopranistin Lilli Lehmann in Berlin. Seit 1890 unternahm sie zahlreiche Konzertreisen durch Deutschland, Österreich, Ungarn und Russland. Seit 1895 wirkte sie zugleich als Pädagogin am Konservatorium von Odessa. 1901 verlegte sie ihren Wohnsitz nach Riga, von wo aus sie 1905 eine Konzerttournee durch Belgien und England unternahm. Schließlich ging sie 1906 nach New York. 1908-10 gehörte sie der Metropolitan Oper New York an (Debüt als Grimgerde in der »Walküre«), an der sie in insgesamt 44 Vorstellungen vor allem Charakterpartien zum Vortrag brachte wie die Flora in »La Traviata«, die Maddalena im »Rigoletto«, die Mercedes in »Carmen«, die Mamma Lucia in »Cavalleria rusticana« und die Marthe im »Faust« von Gounod, dazu trat sie mehrfach in den Sunday Night Concerts der Metropolitan Oper auf. Sie setzte ihre Konzertkarriere in den USA fort und war als gesuchte Pädagogin am Institute of Musical Art in New York tätig. Sie ist aber auch noch in Europa aufgetreten, so 1910 bei einer Deutschland-Tournee, in deren Verlauf sie am Opernhaus von Köln die Amneris sang. Sie starb 1948 in New York.
28.12. Homer Newton BARTLETT: 175. Geburtstag
Biographie des amerikanischen Komponisten auf Englisch: http://www.nysl.nysed.gov/msscfa/sc23062.htm
31.12. Jaap SCHROEDER: 95. Geburtstag
Er studierte 1943-47 Violine bei Jos de Clerck, am Konservatorium seiner Heimatstadt und danach an der École Normale de Musique de Paris bei Jacques Thibaud, Joseph Calvet und Jean Pasquier (1904–92), außerdem studierte er Musikwissenschaften an der Pariser Sorbonne. Nach der Ausbildung war er Konzertmeister beim Kammerorchester von Radio Hilversum. Gleichzeitig regten befreundete Musiker ihn an, mit ihnen das „Nederlands Strijkkwartet“ zu gründen; mit diesem Streichquartett gab er zahlreiche Konzerte in Europa und Nordamerika. 1960 gründete er das Ensemble „Concerto Amsterdam“, dessen Leiter er wurde. Die Konversion des Ensembles in ein Barockorchester erfolgte etwa 1969. So verfolgte er während 17 Jahren die Laufbahn eines klassischen Geigers, bis er, inzwischen zum Kreis von Musikern um Frans Brüggen, Anner Bijlsma und Gustav Leonhardt gehörend, sich ab Ende der 1960er Jahre intensiv mit der Barockvioline und der historischen Aufführungspraxis auseinandersetzte. 1973 erhielt er die Einladung, an der Schola Cantorum Basiliensis eine Klasse für Barockvioline zu gründen. 1975 gründete er das „Quartetto Esterházy“, welches bis 1981 bestehend auf Originalinstrumenten musizierte. 1981 berief ihn Christopher Hogwood als Konzertmeister der Academy of Ancient Music. 1982 wurde er für sechs Jahre zum Gastleiter der neu gegründeten „Smithsonian Chamber Players“ in Washington berufen. Jaap Schröder unterrichtete an zahlreichen Musikfakultäten amerikanischer Universitäten, so an der Yale University, der Virginia- und Maryland-Hochschule, sowie am Peabody Conservatory, der Banff School of the Arts und dem Konservatorium der Stadt Luxemburg. Er widmete sich intensiv der Wiederentdeckung der vergessenen Violinliteratur des 17. und 18. Jahrhunderts. Schroeder war regelmäßig Gastdirigent bei führenden Kammerensembles. Nachdem er während 40 Jahren Gast beim Musikfestival, das jährlich in dem kleinen isländischen Ort Skálholt stattfindet, war, vermachte Schröder 2017 der dortigen Kathedrale seine Musikaliensammlung. Diese bildet den Grundstock für eine einzurichtende Musikbibliothek. Schröder starb einen Tag nach seinem 94. Geburtstag am 1.1.2000 in Amsterdam.
31.12. Albert REISS: 150. Geburtstag
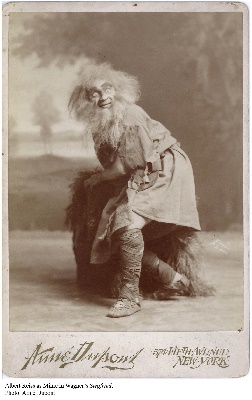
Er war seit 1890 als Schauspieler und als solcher an verschiedenen Berliner Theatern und in Straßburg tätig. Seine Stimme wurde durch Bernhard Pollini und Ernestine Schumann-Heink entdeckt. Darauf Gesangstudium in Berlin bei Wilhelm Vilmar, bei Benno Stolzenberg und bei Julius Lieban. Er debütierte 1897 am Stadttheater von Königsberg in Ostpreußen als Peter Iwanow in »Zar und Zimmermann« von Lortzing. 1898-99 sang er am Stadttheater von Posen (Poznan), 1899-1901 am Hoftheater von Wiesbaden. Er gastierte im Ablauf seiner Karriere an der Münchner Hofoper (1902-07 im Rahmen der Wagner-Festspiele), am Stadttheater Hamburg (1904), in Amsterdam (1907 als David in »Die Meistersinger von Nürnberg«, eine seiner Glanzrollen), an der Grand Opéra Paris (1910 als Melot in »Tristan und Isolde«), an der Oper von Chicago (1911-12 und 1915-16 als Mime im Nibelungenring, seine andere Glanzrolle) und in Den Haag (1924 als Pedrillo in der »Entführung aus dem Serail« mit der Wanderoper von Cornelis Bronsgeest). 1901 wurde er an die Metropolitan Oper New York berufen, und bis 1919 wirkte er als erster Tenor-Buffo an diesem Opernhaus. Er sang dort als Antrittspartie 1901 den Remendado in »Carmen« und danach u.a. den Tavannes in Meyerbeers »Hugenotten«, Heinrich den Schreiber im »Tannhäuser«, den Don Basilio in »Le nozze di Figaro«, den David, den Beppe im »Bajazzo«, den Hirten wie den Steuermann in »Tristan und Isolde«, den Monostatos in der »Zauberflöte«, den Mime im Nibelungenring, den Beppo in »Fra Diavolo« von Auber, den 3. Knappen in der amerikanischen Erstaufführung von Wagners »Parsifal«, den Jaquino im »Fidelio«, den Dikson in »La Dame Blanche« von Boieldieu, den Alfred in der »Fledermaus«, den Normanno in »Lucia di Lammermoor«, den Lampenanzünder in »Manon Lescaut« von Puccini, den 1. Juden in der amerikanischen Erstaufführung der »Salome« von R. Strauss, den Goro in »Madame Butterfly«, den Nando in der amerikanischen Erstaufführung von E. d’Alberts »Tiefland«, den Guillot in »Manon« von Massenet, den Wenzel in Smetanas »Die verkaufte Braut«, den Bardolfo im »Falstaff« von Verdi, den Peter Iwanow, den Barbarino in »Alessandro Stradella« von Flotow, den Kilian im »Freischütz«, den Roderigo in Verdis »Otello«, den Artémidore in der amerikanischen Erstaufführung von Glucks »Armide«, den Bertel in »Versiegelt« von Leo Blech, den Cochenille und den Frantz in »Hoffmanns Erzählungen«, den Gottesnarren in der amerikanischen Erstaufführung von Mussorgskys »Boris Godunow«, den Valzacchi in der amerikanischen Erstaufführung des »Rosenkavalier«, den Acolyte in der amerikanischen Erstaufführung der Oper »Julien« von Charpentier, den Dancaire in »Carmen«, den Schneider in »Der widerspenstigen Zähmung« von Goetz, den Seemann in der amerikanischen Erstaufführung der Oper »Mârouf« von Rabaud, den Boten in »Samson et Dalila« von Saint-Saens, den Scherasmin in »Oberon« von Weber und den Cortez in der amerikanischen Erstaufführung von »La Reine Fiammette« von X. Leroux. Am 10.12.1910 sang er an der Metropolitan Oper in der Uraufführung der Puccini-Oper »La Fanciulla del West« die Partie des Nick, am 28.12.1910 in der Uraufführung der »Königskinder« von Humperdinck den Besenbinder, am 14.3.1912 in der von Horatio Parkers »Mona« den Nial, am 27.2.1913 in der Uraufführung von Walter Damroschs »Cyrano« den Raguneau und am 8.3.1917 in der Uraufführung von Reginald De Kovens »The Canterbury Pilgrims« den Richard. An der Londoner Covent Garden Oper gastierte er 1902-05 und 1924-29 u.a. als David, als Mime und als Valzacchi. Als der Erste Weltkrieg ausbrach, hielt er sich gerade in Nizza auf und wurde durch die französischen Behörden interniert. Erst auf Intervention des Direktors der Metropolitan Oper Giulio Gatti-Casazza konnte er nach New York zurückkehren und seine Karriere fortsetzen. Auch nach dem Eintritt der USA in den Ersten Weltkrieg wurde es ihm im Gegensatz zu den anderen Sängern deutscher und österreichischer Staatsangehörigkeit gestattet, weiter seiner Karriere an der Metropolitan Oper nachzugehen. 1915 wirkte er in Los Angeles in der Uraufführung der Oper »Fairyland« von Horatio Parker mit. 1916 trat er am New Yorker Empire Theatre in den Mozart-Opern »Bastien und Bastienne« und »Der Schauspieldirektor« (zugleich amerikanische Premiere dieser Oper) auf. 1902-05 und nochmals 1924-27 war er zu Gast an der Londoner Covent Garden Oper. Als erster Tenor sang er 1910 mit Zustimmung des Komponisten E. Humperdinck an der Metropolitan Oper die Partie der Hexe, die für eine Altistin geschrieben war, in dessen »Hänsel und Gretel«. Bis 1919 hatte er an der Metropolitan Oper in insgesamt 1075Vorstellungen gesungen. 1919 verließ er die Metropolitan Oper und kam wieder nach Deutschland zurück; hier war er 1923-25 an der Berliner Volksoper, 1925-30 an der Städtischen Oper Berlin engagiert. 1930 beendete er seine Karriere endgültig und zog sich in seine Villa in Nizza zurück, wo er 1940 starb.
Schallplatten: Victor (seit 1911), HMV (hier um 1927, bereits elektrisch aufgenommen, die Szene Siegfried-Mime aus dem »Siegfried« mit Lauritz Melchior), Polydor (Kilian in Kurzoper »Der Freischütz«, 1929); auf Edison-Zylindern singt er Ausschnitte aus Operetten und patriotische Lieder.
31.12. Leopold STROPNICKÝ: 175. Geburtstag
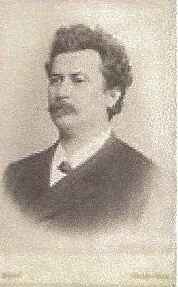
Gesangstudium bei Anna Labler in Prag. Er begann seine Karriere 1868 und war 1872-74 und wieder 1876-84 an der Nationaloper Prag engagiert. Sein Wirken fiel dort in die Epoche, in der Bedrich Smetana als Direktor das Provisorische Nationaltheater (Prozatímní divadlo) leitete. Am 11.6.1881 wirkte er dann in der Uraufführung von Smetanas großer nationaler Oper »Libuse« (»Libussa«) mit, mit der das neu erbaute Haus des Nationaltheaters eingeweiht wurde, das bereits nach zwei Monaten durch ein Großfeuer zerstört wurde. Er wirkte auch in den Prager Uraufführungen der Opern »Wanda« von A. Dvorák (1876), »Die Dickschädel« (»Turdé palice«, 1881), ebenfalls von Dvorák und »Die Braut von Messina« von Zdenek Fibich (28.3.1884 als Manuel) mit. 1884 nahm der vielseitig begabte Sänger von der Bühnenkarriere Abschied, ist aber noch bis 1887 als Konzertsänger aufgetreten und wirkte schließlich in der tschechischen Hauptstadt als Gesangslehrer, wo er 1914 starb.

